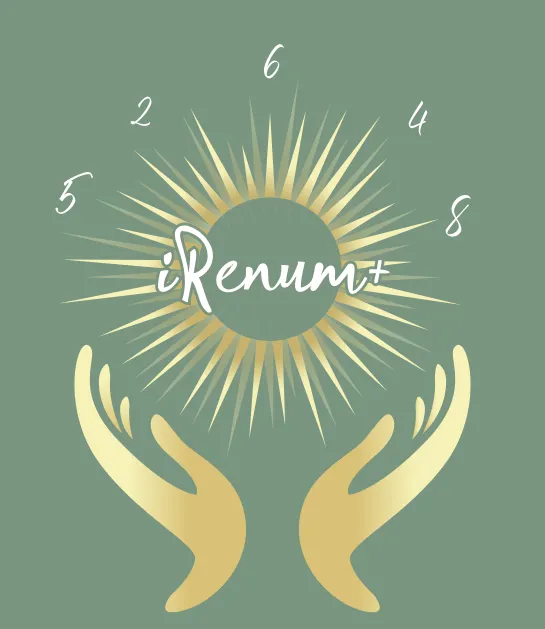

DE
Wenn Du meine Geschichte lieber hören möchtest, findest Du sie jetzt auch als Podcast-Folgen auf meinem Spotify-Account.
🎧 Klicke hier, um direkt zu meinem Profil zu gelangen – oder scrolle weiter, um sie hier zu lesen.
Ein Tag aus meiner Kindheit...
„Irka, geh nach Hause, deine Oma wartet schon mit der Bratpfanne voller gebratener Nadeln!“
Damals verstand ich nicht, was genau dieser Satz bedeuten sollte. Doch ich spürte sofort, dass er nicht freundlich gemeint war. Die Worte trafen mich, auch wenn ich sie nicht ganz einordnen konnte.
Ich war vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, und die Jungs, die das riefen, gehörten zu einer älteren Klasse. Sie waren etwa 14 und ein Schuljahr über mir.
Es war nicht das erste Mal, dass sie mich ärgerten – mit seltsamen Sprüchen, spöttischem Lachen und abwertenden Blicken. Ich merkte, wie sich jedes dieser Worte wie ein kleiner Stich anfühlte, ein Angriff, der mich verunsichern sollte.
Damals begann ich zu begreifen, dass Sprache Macht hat – und dass Hänseleien oft viel tiefer gehen als es zunächst scheint.
Und so machte ich mich auf den Weg nach Hause, wie jeden Abend, denn ich musste immer zu einer bestimmten Uhrzeit zurück sein.
Länger als bis neun Uhr abends durfte ich nicht draußen bleiben – selbst im Sommer nicht. Dabei lebten wir in einem Dorf, wo das Leben an warmen Abenden eigentlich erst spät begann.
Viele Kinder/Jugendliche in meinem Alter kamen oft erst gegen neun nach draußen. Sie halfen vorher noch ihren Familien – im Haushalt, im Garten oder auf dem Feld. Erst danach trafen sie sich, um Volleyball zu spielen oder andere Spiele zu machen, die bei uns im Dorf Tradition hatten.
Ich dagegen war immer die Erste, die nach Hause musste.
Meine Großmutter war streng – aus Liebe, wie ich heute weiß, aber damals empfand ich es nur als einengend. Sie machte sich ständig Sorgen um mich, wollte nicht, dass mir etwas passiert.
Ich fühlte mich ausgeschlossen. Für mich war es, als würde ich das echte Leben verpassen. Als Kind empfand ich ihre Fürsorge als Freiheitsraub.
An dieser Stelle fragst du dich bestimmt, warum es meine Großmutter war – und nicht meine Eltern – zu der ich nach Hause ging...
Ich erinnere mich an einen Abend, als meine Großmutter mich in einer alten Eisenbadewanne wusch.
Das war in der Küche, in dem Raum, wo der Kaminofen stand, auf dem sie das Wasser fürs Baden erhitzte. Das Wasser wurde dann in die Wanne gegossen, und ich erinnere mich bis heute daran, wie heiß es war. Mein kleiner Po – wie meine Großmutter zärtlich sagte, „wie ein Erdbeerchen“ – wurde in dieser Wanne beinahe verbrannt.
Wenn das Baden vorbei war, hob sie mich aus der Wanne und wickelte mich sofort in ein großes Handtuch, damit ich nicht fror – vielleicht auch, damit ich nicht nackt durchs Haus lief.
Dann trug sie mich ins Wohnzimmer. Dort lag schon mein Großvater auf dem Sofa und wartete auf mich. Doch bevor ich mit ihm spielen durfte, zog mich die Großmutter gleich dort – neben dem Sofa – an. Ich erinnere mich genau, wie sie mir ein T-Shirt mit rot-orangenen Punkten über den Kopf zog, wie vorsichtig sie meine kleinen Arme in die Ärmel führte. Und schon in diesem Moment spürte ich freudige Aufregung. Ich zog Strumpfhosen an – weder Röcke noch Hosen –, so war es in meinem Alter üblich.
Wenn ich ganz angezogen war, lächelte mir mein Großvater zu. Er lag da, die Beine leicht angewinkelt, die Hände gemütlich hinter dem Kopf verschränkt. Ich kletterte zu ihm, setzte mich auf seinen Schoß, so wie es Kinder tun, und begann spielerisch auf ihm zu hüpfen. Er lachte, und ich fühlte mich sicher und geliebt.
Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war – vielleicht vier Jahre. Mein Großvater starb im Sommer 1990, ich war da viereinhalb. Ich habe nur wenige Erinnerungen an ihn, aber dieser Moment – er ist einer der wenigen, die mir geblieben sind – klar und warm, wie ein Licht im Nebel meiner frühen Kindheit.
Er hat mich sehr geliebt.
Und viele Jahre später erfuhr ich, dass mein Großvater damals zu meinen Eltern gesagt hatte:
„Ich will Ira.“Er wollte, dass ich bei Oma und Opa lebte.
Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat.
Ich weiß nicht, was er in mir gesehen hat – aber irgendetwas war da.
Etwas, das tief in mir lebte. Etwas, das ich selbst damals noch nicht kannte. Aber ich spürte es schon: Dieses Etwas war besonders.
Doch genau dieses Etwas sollte verborgen bleiben.
Es durfte nicht wachsen, nicht leuchten, nicht gehört werden. Viele spürten das – vielleicht unbewusst – und versuchten, es zum Schweigen zu bringen.
Von Anfang an war alles so eingerichtet, dass ich es in mir niemals entdecken würde. Damit ich nicht glauben konnte, dass meine Seele eine besondere Aufgabe hat.
Aber davon später…
Es geschah an einem warmen Sommertag, als mein Großvater starb.
Er hatte Lungenkrebs, aber ich erinnere mich kaum an seine Krankheit. Ich war zu klein, um zu begreifen, was da geschah.
Aber ich werde nie jene Nacht vergessen, in der man uns – mich und meine drei Schwestern – weckte.
Unsere Eltern wurden von den Nachbarn meiner Großeltern benachrichtigt. Sie hatten die Nachricht überbracht: Großvater war gestorben.
Ich erinnere mich, wie wir im Flur standen – alle vier, verschlafen, verwirrt. Das grelle Licht tat in den Augen weh – ich war gerade erst aufgewacht. Ich verstand nicht, was los war – ich spürte nur die Stille. Und eine gewisse Traurigkeit.
Ein paar Tage vergingen bis zur Beerdigung. Daran habe ich nur vage, neblige Erinnerungen.
An dem Tag, als man mich aus dem Kindergarten abholte, war es nicht Mama und auch nicht Papa – es war meine ältere Schwester. Sie kam, um mich zu holen, während meine zwei anderen Schwestern zu Hause blieben. Allein. Eingeschlossen.
Warum das so war – das weiß ich bis heute nicht.
Was dann geschah, ist wie im Dunkeln.
Von da an war alles wie ausgelöscht – als hätte die Erinnerung die Tür zugeschlagen.
Aber… ich sah ihn noch einmal.
Diese Erinnerung hat sich so deutlich in meinem Kopf eingeprägt, dass ich bis heute nicht weiß – ist es wirklich passiert oder war es nur ein Traum?
Es war bereits einige Zeit nach dem Tod meines Großvaters.
Meine Großmutter bat meine Eltern, mich zu ihr ziehen zu lassen.
Sie hielt die Stille im Haus nicht mehr aus.
Die Räume waren leer, schwer, fast unheimlich. Sie hörte Geräusche, meinte, Türen gingen auf. Sie konnte nicht mehr allein sein.
In ihrer Nähe musste jemand sein – lebendig, atmend, sprechend, sich bewegend.
Sich um mich zu kümmern beruhigte sie, half ihr, durch die Tage zu kommen.
Ob das für uns beide eine gute Entscheidung war – schwer zu sagen.
Damals fragte niemand, ob ein Kind in so einer Situation überfordert oder überlastet sein könnte.
Eine Rolle zu übernehmen, ist das eine.
Aber von den eigenen Eltern getrennt zu werden – das ist etwas ganz anderes.
Später erzählte mir meine ältere Schwester etwas, das ich selbst längst aus meinem Gedächtnis verdrängt hatte:
In der Zeit, als man mich zur Großmutter gebracht hatte, durchlebte ich eine echte emotionale Sturmflut – auch wenn ich es damals nicht hätte so nennen können. Ich wurde bei der Großmutter einquartiert, und gegen Mitternacht überkam mich plötzlich eine solche innere Not, dass ich hemmungslos zu weinen begann. Ich weinte nach meiner Mutter, ich wollte zurück – zu ihr, obwohl es nichts gab, was mich wirklich hätte trösten können.
Und das geschah nicht nur an einem Abend.
Es waren Nächte – über ein halbes Jahr hinweg – in denen ich so sehr nach meiner Mutter schrie, dass ich fast an meinem eigenen Schluchzen erstickte. Ich wollte einfach nur zurück zu ihr. Mit meinem ganzen kleinen Körper.
Doch kaum war ich wieder bei ihr, begann alles von vorn – nur diesmal mit vertauschten Rollen.
Ich schrie nach der Großmutter.
Ich schrie mich wund nach dem einzigen Menschen, bei dem ich mich sicher gefühlt hatte.
Ich wollte zurück – zurück in ihre Wärme, in ihre ruhige, wachsame Gegenwart.
Als würde mein Herz zwischen zwei Welten hin- und hergerissen, ohne zu wissen, zu welcher es wirklich gehört. In der einen sehnte ich mich nach der anderen – und in der anderen vermisste ich die erste.
Ich war zu klein, um all das zu verstehen.
Aber mein Körper erinnerte sich.
Er erinnerte sich an die Angst, an den Schmerz, an das Gefühl des Verlassen-Seins – ganz gleich, auf welcher Seite ich war.
Und ich schrie. Immer wieder.
Nach Liebe. Nach Halt. Nach einem Zuhause, das sich nicht bei jeder Veränderung auflöste.
Ich weiß nicht mehr, wann genau dieser Moment kam, in dem dieses Verlangen verschwand – oder, besser gesagt, in dem ich es losließ. Ich erinnere mich nicht, wann ich die Entscheidung traf, nicht mehr zurückwollen zu wollen.
Es war, als wäre diese Entscheidung still und leise in mein Herz eingezogen.
Bis heute frage ich mich: War es wirklich meine Entscheidung – bei der Großmutter zu bleiben?
Oder war es das frühe Begreifen eines kleinen Kindes, dass die Mutter mich nicht stark genug liebte, um mich bei sich zu behalten? Dass es für sie leichter war, mich wegzugeben – aus den Augen, aus dem Sinn?
Ich denke darüber nach, weil meine Großmutter mir später erzählte, dass es diesen einen bestimmten Tag gab, an dem meine Mutter mich weggeschickt hat. Ich hatte sie um etwas zu essen gebeten, aber sie konnte mir nichts geben. Stattdessen sagte sie:
„Geh zur Großmutter. Komm nicht mehr zurück.“
Und in genau diesem Moment – ich war vielleicht viereinhalb, vielleicht fünf Jahre alt – verstand ich etwas, das kein Kind verstehen sollte:
Dass die Liebe meiner Eltern nicht tief genug war.
Dass es mir bei der Großmutter besser gehen würde – vielleicht für immer.
War das die Logik eines Kindes?
Oder die Seele, die sich ihre Eltern vor der Geburt selbst ausgesucht hatte – und in diesem Augenblick erkannte, dass sie sich nun selbst würde schützen müssen?
Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines:
Nur ein sehr weises Kind kann eine solche Entscheidung treffen.
Wie sich so eine Erfahrung auf den Verstand und die Seele eines Kindes auswirkt – das lässt sich in dieser Geschichte nachverfolgen
.
Und diejenigen, die meine Familie kannten, die wussten, woher ich kam – für sie war das vielleicht gar keine Frage. Für viele war es einfach nur ungerecht…
Ich war das Kind, das weggeholt wurde – gepflegt, satt, umsorgt.
Meine dreijährige Schwester blieb bei unseren Eltern – dort, wo es oft am Nötigsten fehlte.
Im Dorf wurde getuschelt:
„Warum nur Irina? Warum nicht beide?“
So entstand eine leise Unzufriedenheit – Neid auf meine Großmutter, aber auch auf mich.
Ich spürte, dass selbst zwischen uns Schwestern ein Riss entstanden war.
Meine ältere Schwester gab es mir später ganz offen zu: dass sie mir damals neidisch war, mich dafür hasste. Nicht mich als Mensch – sondern das, was ich hatte. Dass ich es besser hatte, während sie oft hungrig ins Bett ging. Ich hatte mehr – und das reichte aus, um ihre Verletzung zu nähren.
Unsere Eltern kümmerte das nicht.
Der Vater trank, und die Mutter war emotional abwesend, überfordert – vielleicht psychisch krank. Keine Diagnose, aber jeder, der mit ihr sprach, spürte es: Irgendetwas stimmte nicht. Sie war nicht präsent, nicht liebevoll, nicht schützend – eine Mutter nur dem Namen nach.
Es fehlte an Essen. Es fehlte an Wärme.
Für meine Schwestern war ich das Kind, das „mehr Glück gehabt“ hatte. Und dieser stille Neid, diese unausgesprochene Bitterkeit wuchsen mit ihnen heran – wie ein Schatten, der nie ganz verschwand.
Selbst die Menschen im Dorf konnten nicht verstehen, warum ausgerechnet ich – und nicht jemand anderes – bei der Großmutter lebte. Für sie war das unbegreiflich. Für mich: schicksalhaft.
Und ich spürte es. Mein ganzes Leben lang.
Ich konnte schon immer Energie wahrnehmen.
Ich brauchte keine Worte, um zu spüren, was verborgen lag.
Und dann war da diese eine Nacht.
Ich wachte plötzlich auf. Das Zimmer war still, der Mondschein fiel silbern durchs Fenster.
Und in diesem Licht sah ich ihn:
Eine hohe, männliche Gestalt – ein Schatten, der direkt am Fenster stand.
Es war mein Großvater.
Großmutters Bett stand direkt gegenüber dem Fenster, und ich sah ganz deutlich, wie sich diese Gestalt langsam in ihre Richtung bewegte.
Ich lag da wie gelähmt. Mein Herz schlug wild, aber mein Körper rührte sich nicht.
Die Angst war so überwältigend, dass ich mich unter die Decke verkroch – als könnte sie mich vor allem beschützen.
Dann schlief ich ein.
Ob es wirklich geschah – ich weiß es nicht.
Aber es hat sich in mich eingebrannt – so lebendig, so real, als wäre es nicht bloß Einbildung gewesen, sondern etwas, das ich tatsächlich gesehen habe.
Später, als ich älter war, erzählte mir meine Großmutter etwas, das sie mir damals nicht zu sagen gewagt hatte:
Dass ich oft nachts aufgewacht und weinend ins Wohnzimmer gelaufen sei, weil der Großvater mich angeblich gezwickt hätte – um mich aus dem Bett zu vertreiben. Es war schließlich sein Bett gewesen.
Sie sagte auch, dass sie es bis heute bereut, mich damals nicht zu sich ins Bett genommen zu haben, wenn ich weinte. Dass sie bis heute nicht versteht, warum sie mich allein ließ, obwohl sie meine Tränen hörte.
Ich erinnere mich nicht an das Zwicken selbst.
Aber ich erinnere mich an das Gefühl – dass da noch jemand war.
Nicht unheimlich.
Einfach nur: da.
Es war meine erste bewusste Begegnung mit dem Jenseitigen, die ich mir bewahren konnte. Und ich bin sicher, dass ich mich daran erinnern sollte – damit dieses Bild mich jedes Mal daran erinnert, wenn ich beginne, an meinen Gaben zu zweifeln.
Damit ich verstehe, aus welcher Ahnenlinie ich diese Fähigkeit geerbt habe – und welche Aufgabe mir damit gegeben wurde…
Irgendwann legte sich der Zwiespalt meines inneren Hin und Her – und ich wurde zu einer Tochter meiner Großmutter.
Nicht durch Geburt – sondern durch all das, was uns miteinander verband.
Ich wurde eine fleißige Schülerin, wissbegierig, ehrgeizig. In der Schule gehörte ich zu den Besten.
Mein Erfolg wurde ganz unterschiedlich aufgenommen. Auch innerhalb meiner Familie.
Meine Großmutter selbst hatte das niemals erwartet.
Sie hatte keine Ausbildung. Während des Zweiten Weltkriegs konnte sie nur zwei Klassen abschließen.
Die Familie war so arm, dass sie keine Winterschuhe besaß, um zur Schule zu gehen.
Und so blieb sie zuhause – mit Grundkenntnissen in Lesen, Schreiben und Rechnen. Mehr war nicht möglich.
Dass ich einmal zu den Besten der Klasse gehören würde, das war für sie kaum vorstellbar. Doch nach jedem Elternabend kam sie zufrieden nach Hause.
Mit einem einfachen Satz, der für mich mehr war als jede Auszeichnung: „Du wurdest wieder gelobt.“
Es war, als wäre es gar nicht nötig, dass sie dorthin ging – ihre Haltung war ruhig, voller Vertrauen. Meine Leistungen waren konstant, stabil und sehr gut.
Was sie mir nie direkt sagte, aber was mir meine Lehrerin eines Tages anvertraute: Immer wenn meine Großmutter über mich sprach, sagte sie diesen einen Satz: „Der Gott selbst hat mir Irina geschickt.“
Diese Worte haben sich tief in mein Herz eingebrannt.
Als wäre ich ein Geschenk. Ein geheimer Plan, den nur sie und das Universum kannten.
Ein leises Wissen, das zwischen uns lebte.
Etwas, das weder erklärt noch bewiesen werden musste.
Ich habe sie einmal selbst gefragt, ob sie das wirklich gesagt hat.
Sie wich mir aus. Lächelte nur. Vielleicht, weil sie wusste, dass manche Dinge sich nicht wiederholen lassen.
Weil sie bereits wahr sind, in dem Moment, in dem man sie fühlt.
Doch zurück zu meiner streberischen Art…
Jeder, der vom Land kommt, weiß, wie kalt die Winter in Kasachstan waren. Manchmal waren die Schneestürme so heftig, dass man kaum einen Meter weit sehen konnte. Der Wind drückte gegen die Fenster, die Wege wurden von Schnee und Eis blockiert.
Ich erinnere mich an einen dieser Tage. Ich war wahrscheinlich in der ersten oder zweiten Klasse, als meine Großmutter mich eigentlich gar nicht zur Schule bringen wollte. Es galt als gesunder Menschenverstand, dass der Unterricht bei solchem Wetter ausfiel.
Aber ich war so verantwortungsvoll – oder vielleicht auch so ängstlich, als schlechte Schülerin zu gelten –, dass ich weinte und bettelte, bis sie nachgab.
Und sie brachte mich tatsächlich zur Schule – durch Schnee und Sturm, die Augen zusammengekniffen, eingehüllt in Mantel und Tücher, hielt sie mich fest an der Hand.
Dort wurde sie von der Schulleiterin zurechtgewiesen: „Wie kann man ein Kind bei diesem Wetter zur Schule bringen?“
„Sie hat so geweint“, sagte meine Großmutter mit Scham. Wir wurden nach Hause geschickt…
Ich war geradezu besessen von der Schule.
Ich habe es geliebt, dort zu sein – mit den Büchern, den Lehrern, dem festen Rhythmus.
Manche würden das nicht glauben. Manche würden vielleicht denken: Das ist doch verrückt.
Aber ich war eben Streberin.
Was die Noten betrifft – und natürlich auch mein soziales Verhalten.
Bis ich älter wurde. Und der Einfluss von außen ein anderer.
Oder vielleicht wollte ich einfach dazugehören.
Doch tief in meiner Seele – da war ich immer eine Rebellin.
Aber bis dieser Moment kam, war ich eine Vorzeigeschülerin.
Viele im Dorf flüsterten am Ende des Schuljahres – weil die besten Schüler damals eine Gramota bekamen, eine Urkunde, und vor die ganze Schule gerufen wurden, um sie entgegenzunehmen.
Man wurde beim Namen genannt – und mein Name wurde jedes Jahr aufgerufen, bis wir Kasachstan verließen.
Doch wie das Leben manchmal spielt, erzeugten meine Noten – Jahr für Jahr lauter Einsen (im deutschen System) oder eben lauter Fünfen (im kasachischen, wo die Fünf das Beste war) – auch andere Reaktionen.
Denn der Name Warkentin war im Dorf kein einfacher Name. Mein Vater galt inzwischen als Dorfbetrunkener.
Und meine Mutter – na ja, sie wurde nicht gerade als Vorzeigefrau oder Ehefrau gesehen.
Dass ein Kind solcher Eltern ein Vorzeigekind sein konnte, war für viele schwer zu akzeptieren.
Besonders, wenn dieses Kind von keiner Unterstützung von außen profitierte … denn alles kam aus meinem Inneren.
Später erzählte mir meine Großmutter, dass ältere Damen im Dorf bei der nächsten Urkundenübergabe hinter vorgehaltener Hand getuschelt hätten – halb erstaunt, halb spöttisch, mit einem Ton, in dem Neid und Missgunst mitschwangen:
„Oh Baba, sie hat tatsächlich eine Einser-Schülerin großgezogen …“
Und meine Oma habe dann nur leise geantwortet – nicht trotzig, nicht stolz, sondern schlicht: „Das war sie ganz allein. Ich habe doch selbst keine Schulbildung, wie kann ich ihr helfen?!“
Und das stimmte. Aber vielleicht war es gerade das, was mich antrieb. Ich war so begeistert vom Lernen, dass ich ihr sogar mit einem Buch in den Erdkeller folgte.
Unser Keller – wir nannten ihn Pogreb – war wie ein kleiner Raum unter dem Fußboden. Dort lagerten wir den ganzen Winter über Eingelegtes aus dem eigenen Garten. Kartoffeln, die wir auf dem eigenen Feld gepflanzt und geerntet hatten, kamen in Säcke, die dann in den Erdkeller getragen wurden – damit wir auch im Winter etwas zu essen hatten.
Ich erinnere mich an eine dieser Situationen: Meine Großmutter stieg hinunter, um Kartoffeln zu holen. Ich, mit einem aufgeschlagenen Buch in der Hand, beugte mich über die Öffnung, hockte mich ans Loch im Boden und las ihr laut daraus vor.
Sie machte sich Sorgen, dass ich hineinstürzen könnte – sie rief: „Pass auf, dass du nicht umfällst!” Aber ich wollte unbedingt vorlesen. Ich wollte ihr zeigen, wie gut ich lesen konnte.
Ich wollte es mit ihr teilen.
Meine Vorliebe fürs Lesen hatte ich schon immer. In den Sommerferien habe ich mir fast alle Bücher aus der Dorfbibliothek ausgeliehen – und gelesen. Ich fand in den Büchern meine Ruhe, eine Welt der Fantasie. Mein Verstand und meine Gedanken liebten es, in eine andere Welt einzutauchen, wo alles möglich war.
Es war so anders als das, was ich aus unserem Dorf kannte. Bis wir Kasachstan verließen, war ich nie in einer Stadt gewesen. Ich war so abgegrenzt von so vielem – und wie in einem Käfig gefangen, gehalten von den Ängsten meiner Umgebung.
Und deswegen gaben mir Bücher mehr Zuflucht, als jede Freundschaft damals es je ersetzen konnte.
Ich wollte gebildet sein. Dieses Verständnis, dass Bücher kluge Menschen hervorbringen, saß tief in mir – schon seit der Kindheit. Und klug sein wollte ich schon immer. Ich weiß nicht genau, woher ich das hatte … vielleicht auch von bestimmten Lehrerinnen.
Aber ich war eine Leseratte. Und wer mich kennt, weiß: Bis heute wähle ich lieber ein Buch als irgendein Treffen, als sinnlos Zeit zu vertrödeln oder mir dumme Netflix-Shows anzusehen.
Bücher haben mir geholfen. Sie haben mir gezeigt, wie man dieses Leben besser machen kann. Sie haben mich getragen – besonders dann, wenn Menschen versucht haben, mich klein zu halten. Wenn sie mir das Gefühl geben wollten, dass ich nichts wert bin.
Und sie haben es oft versucht – jede und jeder auf ihre eigene Weise. „Was glaubst du wer du bist?“ „Du hast nicht das, was man braucht, um erfolgreich zu sein.“ „Prinzessin, pass auf– je höher die Krone, desto tiefer der Fall.“ „Du müsstest schon aus einer wohlhabenden Familie stammen, wenn du wirklich Einfluss haben willst … "oder dazugehören ..."
Manche dieser Behauptungen habe ich bewusst geformt, andere sind wörtlich übernommen worden. Wie schon gesagt: Ich konnte schon immer die Energie lesen. Es ist schon merkwürdig: Je mehr ich mich mit mir selbst auseinandersetzte, desto weniger wollte ich dazugehören. Doch das wird sich im Laufe dieses Buches noch deutlich zeigen …
Es gab aber auch traurige Momente mit den Büchern – manche kann man als traumatisch bezeichnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vielleicht sechs oder sieben Jahre, denn es ging um die Fibel – das erste Lesebuch, das jedes Kind in der Sowjetunion in die Hand bekam. An jenem Tag war ich bei meinen Eltern zu Besuch. Sie wohnten nur zwei Straßen weiter und ich ging oft hin, um meine Geschwister zu sehen. An diesem Nachmittag waren nur meine Mutter und ich zu Hause. Natürlich hatte ich meine Lesefibel dabei – so streberisch war ich. Ich murmelte leise vor mich hin, weil mein Lesen noch nicht sicher war, aber ich übte eifrig weiter.
Irgendwann wurde meine Mutter ungeduldig. Sie ermahnte mich mehrmals, aufzuhören, weil mein Gemurmel sie störte. Aber ich las weiter – und dann riss sie mir das Buch aus den Händen und warf es wütend auf das Feuer im alten Kaminofen. Die Flammen verschlangen das Buch sofort …
Ich schrie auf und begann zu weinen. Und als ob das nicht genug gewesen wäre, sagte sie kalt zu mir: „Hör auf zu heulen, sonst gibt es Schläge.“
Diese Szene jagt vielen einen Schauer über den Rücken – allein die Vorstellung, dass eine Mutter ihrem Kind so etwas antut. Doch hinter dieser Handlung stecken so viele Fragen: Welche Art ist ihr Schmerz? Welches Bildungsniveau hat sie? Wo ist ihr Mitgefühl, ihre emotionale Stabilität? Und wie sehr prägt so etwas ein Kind?
Ja, dieser Moment brannte in mein Gedächtnis ein. Aber ich habe das Lesen nicht verlernt. Im Gegenteil: Mein Verlangen danach ist nur noch stärker geworden. Ironischerweise wuchs aus der Flamme, die meine Kraft vernichten sollte, meine eigene Stärke. Heute arbeite ich mit Feuerenergie – das, was damals meine Leidenschaft zerstören sollte, hat mich entfacht.
In meiner Kindheit kam es immer wieder vor, dass meine Mutter mir körperlich Grenzen setzte – manchmal auch auf harte Weise.
Und es gab viele Momente, die ich mit der Zeit verdrängt habe – bewusst und unbewusst. Eine Situation ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: Ich stürmte völlig außer Atem durch die Haustür, verfolgt von ein paar Jungs aus dem Dorf, die ich zuvor gereizt hatte. Die Tür fiel zu – sie war schon in so schlechtem Zustand, dass selbst die Wucht eines zwölfjährigen Mädchens ausreichte, sie zu beschädigen.
Meine Mutter reagierte heftig – aus Wut und emotionaler Überforderung schlug sie mir ins Gesicht.
Dann begannen wir zu streiten – laut, impulsiv, voller gegenseitiger Vorwürfe. Ich erinnere mich, dass sie sagte: „Ich bin deine Mutter.“ Und ich entgegnete ihr: „Nicht die Frau, die ein Kind zur Welt bringt, ist die Mutter – sondern die, die es großzieht.“
Autsch! Das saß tief.
Sie war überzeugt, ich hätte diesen Satz von meiner Großmutter gelernt. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, woher ich ihn hatte. Ich hatte damals nur den Mut, ihn auszusprechen – aber nicht die emotionale Reife, die Wirkung meiner Worte wirklich zu verstehen.
Heute würde ich das wohl anders formulieren – mit mehr Bewusstsein für die Verletzlichkeit, die in einer Mutter mitschwingt. Oder vielleicht würde ich es gar nicht sagen, so viel hat sich verändert.
Heute sehe ich vieles mit anderen Augen. Nicht, dass ich das Weggeben unterstütze, aber ich beginne zu verstehen, unter welchen Umständen es geschehen ist. Ich begreife langsam, wie sehr Überforderung, fehlende Unterstützung und inneres Chaos eine Rolle spielten.
Meine Großmutter erzählt bis heute, wie ich oft mit blauen Flecken nach Hause kam, wenn meine Mutter einen ihrer Ausbrüche hatte. Ich selbst erinnere mich kaum daran – nicht, weil es nicht passiert ist, sondern weil ich mir früh antrainiert habe, solche Erinnerungen auszublenden.
Später lernte ich, dass das eine bekannte psychologische Reaktion ist: Ein traumatisiertes Kind blendet das Schmerzvolle aus, um zu überleben. Um irgendwie weiterzumachen.
Ich erinnere mich an einen Moment, als ich meiner Nachbarin, auf deren Kind ich damals aufgepasst habe, erzählt habe, dass meine Großmutter immer schreckliche Sachen über meine Mutter sagt. Sie konnte nicht verstehen, warum ich dadurch keinen Bezug zu meiner Mutter hatte, und meinte, meine Oma solle das nicht tun, weil meine Mutter eben meine Mutter sei.
Damals verstand ich das alles nicht. Und wie sehr die eingeprägte Weisheit anderer meine Gefühle und meine Beziehung zu meinen Eltern beeinflusst hat, wurde mir erst später bewusst.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Großmutter nicht ganz nachvollziehen konnte, dass sie damit ein Kind emotional vorprogrammierte. Sie sagte nur die Wahrheit, nichts davon war gelogen. Doch es fehlte ihr die emotionale Reife, zu verstehen, wie ein Kind das aufnimmt und wie sich daraus eine Meinung bildet.
Dies hier ist meine Erinnerung – keine Schuldzuweisung oder Anklage. Es sind Umstände, die meine Gefühle gegenüber meinen Eltern geprägt und beeinflusst haben, neben meiner persönlichen Erfahrungen, die ich selbst machen durfte.
Zwischen meinem zwölften und vierzehnten Lebensjahr begann ich, die Jungs im Dorf bewusst herauszufordern. Ich wurde frech, provozierte sie – und liebte das Gefühl, gejagt zu werden. Ich ließ mich auf Rangeleien ein, körperlich, laut, wild. Etwas in mir wurde in diesen Momenten lebendig. Ich wusste nicht, was es war, konnte es nicht benennen. Erst viele Jahre später, über dreißig, als ich in Kanada mit Kickboxen begann, erkannte ich: Das war mein innerer Kampfgeist.
Ich blühte regelrecht auf, wenn ich mich körperlich fordern konnte. Diese Energie, dieser Drang nach Bewegung und Durchsetzung – das war ich. Schon immer. Nur hatte es in meiner Kindheit nie einen Ort gegeben, an dem diese Kraft sicher gelebt werden durfte. Abgesehen von der körperlichen Arbeit im Garten, im Haushalt und all dem, was eben anfällt – da war nichts. Ich tat, was getan werden musste: Pflanzen, Unkraut jäten, Wäsche waschen, Haushalt. Tag für Tag. Ich habe diesen Tätigkeiten nie Liebe entgegengebracht – sie waren bloße Pflicht, keine Herzenssache. Mechanisch, still, erwartungsgemäß. Ich war vorbildlich.
Meine Großmutter machte sich jedoch aus ihrer Angst heraus große Sorgen. Ich war dreizehn, vielleicht vierzehn, und begann, auf die Jungs anders zu wirken. Sie wollte mich beschützen – nicht nur vor ihnen, sondern vor dem, was ich selbst noch nicht einschätzen konnte.Ich verstand ihre Angst damals nicht. Ich wollte einfach nur raufen, nicht flirten. Ich sehnte mich nach einer direkten, sportlichen Auseinandersetzung, nicht nach Nähe im romantischen Sinn. Aber mit einem gehbehinderten Vater, einer emotional überforderten Mutter und einer alten Großmutter war ich – zumindest theoretisch – ein leichtes Ziel. Und genau das war die Sorge meiner Oma.
In unserem Dorf mit seinen rund 3000 Einwohnern gab es kaum Möglichkeiten, sich in einem Verein anzumelden oder seine Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken. Vielleicht habe ich deshalb so früh Zuflucht in Büchern gesucht. Ich hatte Freunde – ja. Aber mit den Mädchen in meiner Klasse kam ich selten gut klar. Es war ein ständiges Auf und Ab. Immer wieder gab es Konflikte, immer wieder fühlte ich mich ausgeschlossen. Ich wurde auch öfter ausgegrenzt, Kinder können sehr fies sein.
Der Grund war einfach: Ich war anders. Ich war oft wie aus der Zeit gefallen – das Leben mit meiner Großmutter war langsam, altmodisch, weit weg von dem, was bei anderen Mädchen in meinem Alter gerade „in“ war. Ich war ein kluges Kind aus einem Elternhaus, aus dem man – nach gängiger Meinung – keine „Erfolgsgeschichten“ erwarten durfte. Aber man sah mein Potenzial. Und das machte Angst. Ich spürte den Neid. Vielleicht sogar Eifersucht. Gefühle, die nicht aus den Kindern kamen –sondern von den Eltern übernommen wurden. Und so wuchs in mir dieses Gefühl: Ich bin nicht gut genug. Trotz aller Leistungen, trotz aller Anerkennung. Denn von Geburt an fehlte die Liebe – und draußen wurde das, was in mir leuchtete, unterdrückt.
Ich war das Kind, das auf Elternabenden hervorgehoben wurde. Ich habe an unzähligen Wettbewerben teilgenommen – und sehr oft den ersten, nur manchmal den zweiten Platz belegt.
Ich konnte alles. Besonders in der Sprache lag meine Stärke: Gedichte, Reden, emotionale Darstellung – das war mein Terrain. Wie interessant im Rückblick: Genau diese Fähigkeit entspricht der Zahl Fünf – numerologisch gesehen. Und ich bin am 23. geboren, was ebenfalls eine 5 ergibt. Und genau das wurde mir genommen.
Die Stärke meines Ausdrucks, meine Gabe im Wort, wurde später im Leben zu meiner Schwäche. Erst vor kurzem habe ich verstanden, warum diese Gabe unterdrückt werden musste – nicht nur in der physischen Welt, sondern mehr auf der feinstofflichen, spirituellen Ebene.
Und wie man es erwarten kann, hat meine Liebe zum Lernen und zur Bildung auch mein Verständnis von der Welt geprägt und mich immer weitergeführt – natürlich Hand in Hand mit meiner inneren Stimme, die unglaublich stark ist und jeden Tag stärker wird.
Ich war so stolz darauf, dass mein Vater keinen handwerklichen Beruf ausgeübt hat. (Nicht, dass Handwerk etwas Schlechtes wäre, aber ich hatte immer großen Respekt vor intellektueller Leistung, dem Einsatz eigener Kraft mit Kopf und Sprache.) Das hat mich tief beeindruckt. Wahrscheinlich habe ich diese Haltung aus meinen Büchern übernommen, denn in meiner Familie war niemand in einem solchen Feld tätig.
Mein Vater hatte Buchhaltung gelernt und war der Einzige in der Familie, dem eine Kopftätigkeit möglich war – weil er gehbehindert war und als Mann keinen Handwerkerjob ausüben konnte. Mein Großvater hatte früh Druck gemacht, dass mein Vater etwas Erlerntes mache, etwas, „wo man mit dem Kopf arbeitet“ – vielleicht auch, weil er selbst das nie getan hatte.
Wie dem auch sei: Ich verstand schon sehr früh, dass er, obwohl er in einem Dorf-Autohaus arbeitete und Papierkram erledigte, irgendwie doch dazugehörte. Trotzdem galt er nicht als solcher – besonders nicht, nachdem er in die Trinkerei rutschte und zum berüchtigtsten Alkoholiker des Dorfes wurde. Ein Mann, der vom Schicksal bestraft wurde und sowieso nicht als richtiger Mann angesehen wurde, hat wahrscheinlich aus der Angst, nicht dazuzugehören, auch der Versuchung nachgegeben, von den anderen Männern im Dorf beeinflusst zu werden – dass Alkohol „richtige Männer“ macht, und wer am selben Tisch die Gläser umkippt, ist einer von allen.
So verging meine Kindheit, und die meiner Geschwister, während er trank, sein Geld an andere Leute weitergab, um dazuzugehören, um eine gewisse Art von Anerkennung zu spüren. Es ist fraglich, ob er es auch getan hat, weil er mit seiner Situation nicht klarkam und sich als Opfer stellte und so sein Leben gestaltete.
Irgendwann begriff ich, dass er nicht der Vorzeige-Vater war, den ich mir ausgemalt hatte. Ich erinnere mich an den Tag, als er zum Essen zu meiner Oma kam – während meine Mutter und meine Geschwister an diesem Abend wie an vielen anderen nichts zu essen hatten. Meine Großmutter sorgte ein Leben lang für ihn – kümmerte sich sogar um seine Wäsche, weil meine Mutter es nicht tat (oder nicht nach seinen Vorstellungen).
Das kann ich meinem Vater nicht übel nehmen: Meine Oma war sauber und ordentlich, und sie wollte, dass er genauso aussah. Doch die Verantwortung für seine eigene Familie übernahm mein Vater nie – wie auch, wenn er selbst wie ein Kind behandelt wurde? Er war ja schließlich gehbehindert – vom Schicksal bestraft, wie meine Oma immer sagte.
Man kann das mütterliche Herz schon verstehen, auch wenn seine Ausgangssituation kein Grund für sein Verhalten war. So entwickelten sich in mir die Glaubenssätze, dass schwache Männer nichts in meinem Leben verloren haben. Und so entschied ich unbewusst, dass ich die Starke sein werde.
Wie sich das auf mein Leben ausprägte, kannst du dir wahrscheinlich denken – meine Beziehungen zu Männern… na ja, ich hasste schwache Männer. Und was glaubst du, wen ich immer angezogen habe?
Meine Schwester Maria erzählte mir später, dass sie das Essen manchmal vor ihm versteckt hatte – weil er nicht nur bei Oma gegessen hatte, sondern auch zu Hause alles leer machte, ohne etwas für die Kinder übrig zu lassen. Angeblich sei ich damals – mit zehn Jahren – ihr gegenüber als seine Beschützerin aufgetreten. Ich hatte mich tatsächlich gegen meine siebzehnjährige Schwester gestellt und ihr vorgeworfen, egoistisch zu sein, weil sie ihm das Essen vorenthielt. Man darf nicht vergessen, dass ich auch noch das Kind war, das immer sauber und zu essen hatte ... es gab Abneigung nicht nur meinem Vater gegenüber, ich war ja schließlich auch ein Grund für ihre Frustration ... Aber dieser Mut, mich so klar zu positionieren, erwachte damals in mir – mit zehn. Und während ich das hier schreibe, wird mir bewusst: Ich war noch mutiger, als ich es in Erinnerung hatte. Diese Erkenntnis schenkt mir ein tieferes Verständnis dafür, warum mir dieser Mut später wieder entzogen wurde. Ich sage ganz bewusst: entzogen. Denn ich wurde im späteren Leben auf einer anderen Ebene angegriffen – energetisch. Magisch. Und ich wusste es. Ich wusste sogar, von wem. Meine hellsinnige Wahrnehmung war schon immer da – auch wenn ich sie damals noch nicht in Worte fassen konnte. Doch diese Erkenntnis, dass mein Vater nicht das Vorbild war, das ich mir erhofft hatte, veränderte etwas in mir. Ich verlor den Respekt vor ihm – zumal diese Haltung von allen Seiten bestätigt wurde, sogar von meiner Großmutter. Meine Eltern wurden öffentlich als „Rabeneltern“ gebrandmarkt – und in gewisser Weise stimmte es ja auch. Durch diese Vorwürfe schwanden nicht nur Respekt, sondern mit der Zeit auch meine Liebe zu ihnen, zumindest dachte ich bis vor kurzer Zeit so ... Aus all dem begann eine zerstörte Beziehung zu wachsen, die sich über die Jahre zu einem richtigen Problem entwickelte. Ich sah meinen Vater meist betrunken und er übernahm keine Verantwortung für seine Kinder. Ob ihm bewusst war, dass seine Tochter eine vorbildliche Schülerin war und seiner Mutter so viel aushalf, weiß ich nicht. Ich wurde zur Helferin meiner Großmutter –im Garten, wo jeden Sommer Tag für Tag die Pflanzen gegossen werden mussten. Ich half beim Sägen des Holzes für den Winter, beim Pflücken der Früchte – Tätigkeiten, die ich oft hasste, und dann gemeinsam mit Oma erledigte. Und das habe ich immer dann gemacht, solange die anderen Kinder draußen spielen durften ... Bereits mit elf Jahren begann ich, meine eigene Wäsche zu waschen. Wir hatten keine Waschmaschine, also wusch ich jedes Kleidungsstück von Hand. Ich tat es mit Sorgfalt und Eifer, immer bemüht, ein Vorbild zu sein.
Und doch wurde mir ständig klargemacht, dass ich nicht genug war. "Ich liebe dich" hörte ich nie. Meine Großmutter war sehr sparsam mit Zuneigung, von Natur aus misstrauisch und von so viel Angst erfüllt, dass sie kaum ihre Liebe aussprechen konnte. Manchmal frage ich mich, wie ich es geschafft habe, so positiv zu bleiben. Viele Menschen verstehen nicht, woher ich meine Lebensfreude nehme. Meine Selbstliebe musste ich mir hart erarbeiten, und doch wusste ich immer, dass etwas Besonderes in mir steckte.
Meine Beziehung zu den Mitschülern war stets wechselhaft: Manchmal gehörte ich zur Clique, manchmal hetzte die ganze Gruppe gegen mich. Man hänselte mich auch wegen der getragenen Klamotten, die ich aus Deutschland trug. Unsere Verwandten schickten Pakete mit Süßigkeiten, Lebensmitteln und Kleidung – um meiner Großmutter zu helfen. Und so bekam ich auch alles, was mitgeschickt wurde, für mich. Ich war immer fasziniert von allem,was aus dem Ausland kam, und unendlich dankbar, dass mein Onkel und seine Familie uns so großzügig unterstützten. Das war keineswegs selbstverständlich, und diese Dankbarkeit bleibt bis heute, trotz aller Entwicklung in unseren Familien.
Gleichzeitig aber machte mich diese Andersartigkeit sichtbar. Ich fühlte mich nicht nur wegen meiner Kleidung fremd, sondern auch, weil ich bei meiner Großmutter lebte und nicht wie die anderen Kinder in einer klassischen Familienstruktur aufwuchs. Ich war einfach nicht wie sie. Damals wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dazuzugehören. Heute weiß ich, dass das Universum mich darauf vorbereitet hat, nicht dazuzugehören. Und heute bin ich sogar stolz darauf – ich lebe mein Leben bewusst so.
Diese Unsicherheiten wurden mir besonders bewusst, wenn wir einmal im Jahr Besuch von meiner Tante mit ihren Kindern bekamen. Sie lebten zwar ebenfalls in einem Dorf, aber viel näher an einer Stadt, und in meiner Vorstellung war ihr Leben moderner, lebendiger und selbstverständlicher als meines. Sie brachten immer die tollsten Spielsachen, die schönsten Klamotten mit, und ich sah in ihnen alles, was mir fehlte. Sie stammen aus einer stabilen Familie, wurden von beiden Elternteilen geliebt und umsorgt, und das spiegelte sich in ihrem Auftreten wider. Ihr Selbstbewusstsein wirkte für mich wie aus einer anderen Welt. Zumindest hielt ich es in diesem Moment für Selbstbewusstsein…Der Kontrast zwischen uns war spürbar, und er spiegelte sich in meinem eigenen Selbstbild wider.
Trotzdem verstanden wir uns gut, und ich liebte diese Besuche sehr. Das Haus war plötzlich laut, voller Leben, es wurde gespielt, gelacht und gestritten. Und umso trauriger und stiller wurde es, wenn sie nach einer Woche wieder fuhren. Dann musste ich mich wieder an die allgegenwärtige Ruhe gewöhnen, die mir damals so schwerfiel.
All diese Erlebnisse ließen in mir den Wunsch reifen, das Dorf unbedingt verlassen zu wollen. Ich spürte so klar, dass ich dort nicht bleiben konnte, wenn ich wachsen wollte. Und der einzige Weg, der mir offen stand, war über die Bildung. Nur wenn ich an die Universität ging, hatte ich eine reale Chance, mein Leben selbst zu gestalten und etwas anderes zu erleben als das, was mir im Dorf bevorstand. Deshalb wollte ich es unbedingt. Deshalb wares mein größter Traum, die Schule mit einem "roten Diplom" abzuschließen und dann zu studieren.
Meine Enttäuschung war umso größer, als meine Großmutter mir sagte, sie könne es sich nicht leisten, mich an der Universität anzumelden oder mich in die Stadt zu schicken. Das Geld war nicht da für diese Pläne. Man prophezeite mir, dass ich nach der 11. Klasse wohl nur einen Job im Dorf finden und wahrscheinlich schon sehr früh eine eigene Familie gründen würde… Schon damals war eine Familiengründung nie mein größter Wunsch und stand nie auf meinem Lebensresümé.
Das war auch ein Alptraum für mich: sich nicht weiterzuentwickeln – und je größer diese Vorstellung wurde, desto stärker wuchs in mir der Wunsch, so schnell wie möglich nach Deutschland zu kommen. Wir hatten längst die Anträge für die Spätaussiedlung eingereichtund auf eine Antwort gewartet.
Und in diesem Lebensabschnitt gab es nichts, was darauf hindeutete, dass ich eines Tageszur Heilerin werden würde oder meine spirituelle Entwicklung in den Vordergrund stellen würde. Ich hatte keine bestimmte Vorstellung, wie mein Leben aussehen sollte, aber ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall im Dorf bleiben wollte. Dort gab es überhaupt keine Chancen für persönliche Weiterentwicklung, geschweige denn für irgendeine Verbindung zur modernen Welt, die mich so faszinierte – die Welt, die ich nur aus dem schwarzweißen Fernseher kannte ...
Umso größer war meine Freude in jener Nacht, als wir die Zusage erhielten: Im Jahr 2000 durften wir nach Deutschland einreisen.
Doch bevor ich über den Umzug spreche, möchte ich etwas anderes teilen.
Etwas, das mir bis heute tief unter die Haut geht: die Menschen, die ich zurücklassen musste. Noch bevor alles überhaupt beginnt.
Meine Eltern waren offiziell Lebenspartner, aber sie waren nicht verheiratet. Und genau das wurde später zu einer großen Hürde, als es darum ging, nach Deutschland auszureisen. Vieles musste geregelt, geklärt, geordnet werden. Und eine Sache war dabei besonders wichtig – eine Entscheidung, deren Tragweite mir erst viel später bewusst wurde: Meine Großmutter musste mich nach kasachischem Recht offiziell adoptieren. Nur so durfte ich das Land überhaupt ohne meine Mutter verlassen.
Denn meine Mutter und alle anderen Geschwister blieben zurück: Maria, Olga, und Valentina.
Meine Mutter wollte damals nicht mitkommen – Deutschland war nie ihr Ziel.
So sagte sie es.
Nicht, weil das Leben im Dorf schöner gewesen wäre.
Sondern weil sie keine wirkliche Vorstellung davon hatte, wie viel schöner ihr Leben sein könnte.
Es war ihre Unerfahrenheit. Ihre innere Begrenzung.
Und vielleicht auch eine stille Angst vor dem Unbekannten.Als dann der Moment kam – als mein Vater, meine Großmutter und ich aufbrechen sollten –
da wollte sie plötzlich doch mitkommen.
Doch da war es bereits zu spät.
Und ich hatte drei Schwestern, die ich zurückliess.
Mit der jüngsten teilte ich beide Eltern – mit den älteren beiden verband mich unsere gemeinsame Mutter. Und doch war da für mich nie ein „mehr“ oder „weniger“.
Geschwister sind Geschwister.
Wir alle wurden unter demselben Herzen getragen, und das war das, was für mich zählte, und immer noch zählt, heutzutage mehr als jemals zuvor.
Gefühlsmäßig machte ich keinen Unterschied. Ich liebte sie alle.
Und doch – auf einer tieferen Ebene, die sich nur schwer in Worte fassen lässt – war da eine besondere Schwingung zwischen mir und der Jüngsten: Valentina.
Nicht im Außen. Nicht in der Biografie. Sondern seelisch.
Es war, als ob ich wusste, dass sich unsere Seelen auf einer feineren Frequenz begegnen sollten –
doch diese Verbindung war nur ganz zart spürbar. Kaum greifbar. Und gerade deshalb so spürbar.Ich konnte es fühlen. Wie eine leise Erinnerung an etwas, das nie ganz gelebt wurde.
Man hatte uns sehr früh voneinander getrennt. Und nicht nur das – es war, als hätte jemand einen unsichtbaren Pfeil zwischen uns geschlagen, eine feine Trennlinie, die mit den Jahren immer schärfer wurde.Die Menschen im Dorf begannen, sich gegen mich zu stellen.
In ihren Augen war es meine Schuld, dass ich es besser hatte.
Dass ich mich – so dachten sie – für etwas Besseres hielt.Und wenn ich ganz ehrlich bin:
Ein Teil davon stimmte.
Nicht, weil ich mich über sie stellte –
sondern weil ich tief in mir spürte,
dass ich anders war.
Nicht nur anders als sie.
Anders auf einer Ebene, die älter war als Worte.
Es fühlte sich an, als wäre meine Seele in eine Ahnenlinie gepflanzt worden,
zu der sie nie ganz gehören sollte.Als wäre ich hier – und gleichzeitig nicht von hier.
Wie ein leiser Irrtum der Zeit.
Oder vielleicht eine bewusste Platzierung des Universums,
die mich daran erinnern sollte:
Du bist hier,
aber du bist nicht dieses Hier.
Ich spürte diesen Unterschied. Ich nahm wahr, dass mein Leben in manchen Dingen leichter war, strukturierter, vielleicht auch sicherer. Und irgendwo in mir begann ich zu glauben, dass ich deshalb zu einer anderen Welt gehörte. Einer, die nicht für alle da war – und die ich deshalb schützen musste. Auch vor ihr.
Ich hatte den Unterschied zwischen unseren Lebenswelten irgendwann erkannt. Ich spürte, dass ich etwas hatte, was sie nicht hatte – mehr Sicherheit, mehr Möglichkeiten, mehr Aufmerksamkeit. Und mit der kindlichen Härte, die entsteht, wenn man sich seiner Gefühle nicht bewusst ist, habe ich ihr genau das auch gezeigt. Nicht aus Bosheit, sondern aus einem verwirrten Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Und ich glaubte, das „Dazugehören“ müsse man beschützen.
Besonders wenn unsere Verwandten zu Besuch waren, fühlte ich mich wie in einer anderen Welt.
Nicht wegen ihnen – sondern wegen dem, was sie mitgebrachten.
Etwas in ihrer Gegenwart erinnerte mich daran,
dass es noch etwas anderes gab.
Etwas jenseits des Dorfes, jenseits der Enge, jenseits des Alltags.
Sie kamen von außen –
und allein ihre Anwesenheit öffnete in mir ein Tor.
Zu einer Weite, die ich bis dahin nur in meinem Inneren gespürt hatte.
In diesen Momenten wurde ich fast schützend um das, was ich war.
Um das, was ich fühlte, was ich ahnte.
Und manchmal wollte ich niemanden dabei haben.
Nicht einmal meine Schwester.Ich wollte dieses Gefühl ganz für mich.
Dieses heimliche Staunen.
Dieses leise Wissen:
Es gibt mehr.
Ich schloss sie aus. Nicht aus Kälte. Sondern weil ich ahnte, dass genau dieses Gefühl ein zarter Schlüssel war – zu dem, was einmal mein Weg werden sollte.
Sie blieb zurück… Mein Vater versprach ihr, dass er sie und meine Mutter später nachholen würde. Und das hat er auch getan – doch es hat fünf lange Jahre gedauert. Erst im Jahr 2005 durften sie schließlich nach Deutschland einreisen.
Aber zurück zu unserer Beziehung.
Wir waren nur ein Jahr auseinander – und sahen uns zum Verwechseln ähnlich. So sehr, dass man uns ständig verwechselte. Sie wurde oft „Irina“ genannt – und ich wurde genauso oft mit ihrem Namen angesprochen: Valentina.
Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich damals war, vielleicht fünf. Ich ging noch in den Kindergarten. Und ich erinnere mich an einen bestimmten frühen Morgen, an dem ich sie wie so oft auf dem Weg dorthin abholte.
Ich trat in den Raum, und meine Mutter war gerade dabei, ihr die Haare zu kämmen.
Aber es war kein zärtliches Kämmen.
Es war ein Ringen. Mit Kraft. Mit Wut. Ohne jede Einfühlsamkeit.
Meine Schwester, dieses zarte, viel zu schlanke kleine Mädchen, weinte. Sie weinte, weil das Kämmen ein Kampf war – nicht nur gegen das krause Haar, sondern gegen sie selbst.
Meine Mutter zwang sie mit fast schon kalter Strenge dazu, dieses grausige Haar zu „zähmen“. Und dabei sagte sie immer denselben Satz: „Terpi, kasak, atamanom budesh.“
Ein Spruch, wahrscheinlich aus alten sowjetischen Filmen. Er bedeutete sinngemäß: „Nur wer Schmerz aushalten kann, wird stark – und wird als Kasake anerkannt.“
Ein Satz wie eine innere Prägung. Hart. Ohne Wärme. Und ohne Raum für Kindsein.
An solchen Morgen gingen wir dann gemeinsam in den Kindergarten.
Ich weiß nicht mehr, ob ich allein war oder ob unsere Mutter uns brachte. Aber ich erinnere mich an diese Momente:
Man sah uns beide – und sprach uns manchmal mit den falschen Namen an.
Und schon damals konnte ich es kaum ertragen, wenn man meine Identität mit der einer anderen verwechselte.
Vor allem, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich – im Vergleich – „mehr“ war. Mehr gesehen. Mehr gewollt. Mehr beachtet.
Heute frage ich mich:
Woher kam dieses Gefühl, dass ich aus „besseren Verhältnissen“ stammte?
Dass ich – obwohl wir doch zur selben Familie gehörten, aus demselben Blut, demselben Haus – irgendwie mehr war als sie?
War es die stille Erinnerung meiner Seele?
Eine Ahnung aus einem anderen Leben – vielleicht eines, in dem ich aus edlen, gebildeten, geistig reichen Kreisen stammte?
Oder war es das Bild, das die Menschen im Dorf von mir gezeichnet hatten?
Das Mädchen mit dem klugen Kopf, den guten Noten, dem glatten Haar und einem hübschen Gesicht.Vielleicht beides.
Aber eines weiß ich:
Meine Seele war verwirrt.
Sie wusste nicht, wohin sie gehörte.
Zur „besseren“ Gruppe, zu der man mich zählte – oder zu meiner eigenen Familie, zu meiner Schwester, mit der ich doch verbunden sein sollte? Wollte ich überhaupt zu der „besseren“ Gruppe gehören?
Und wer hat eigentlich bestimmt, welche Gruppe besser ist?
Wer hat sich das Recht genommen, über meine Zugehörigkeit zu entscheiden oder meine Gefühle deswegen zu manipulieren?
Diese Verwirrung trug ich über viele Jahre in mir. Eine stille, zähe Frage: Wer hat uns getrennt? Wer hat diesen Keil zwischen uns geschlagen?
Ich habe mir diese Frage mein Leben lang gestellt.Denn es gab Menschen – und ich nenne sie bewusst so: bestimmte Menschen – die es nicht verheimlichten.
Sie beneideten mich. Für meine schulischen Leistungen. Für mein Aussehen. Für mein Denken. Für mein „Herausstechen“.
Und sie hatten meine Schwester an ihrer Seite – eine stille, formbare, suchende Seele – und sie nutzten das aus.Sie brauchten nur ein offenes Ohr, ein kindliches Herz – und machten es zu einem Resonanzraum für Spott und Spaltung.
Sie zogen über mich her – und meine Schwester hörte zu. Immer wieder.
Ohne dass sie es je begriff.
Ich glaube bis heute nicht, dass sie versteht, was damals geschah.
Dass man uns absichtlich gegeneinander aufgehetzt hat.
Dass man ihre kindliche Wut, ihre Ohnmacht, ihr Gefühl von „Nicht-genug-Sein“ auf mich lenkte.
Und dass sie all das – Jahre später – in Form von Kälte, Ablehnung, manchmal fast Hass, wieder an mich zurückgegeben hat.
Wir hatten viele gemeinsame Freundinnen – wir waren ja fast gleich alt.
Und jedes Mal, wenn ich von den Mädchen ausgeschlossen wurde, weil ich irgendwie „anders“ war, wurde unsere Geschwisterverbindung instrumentalisiert.
Man nutzte sie, um auch sie gegen mich zu stellen.
Es war, als fänden andere eine perfide Freude daran, unsere Nähe zu spalten – um einen Schuldigen zu haben. Und der war schnell gefunden: ich.
Man warf mir vor, eine schlechte Schwester zu sein. Und dabei war ich selbst noch ein Kind.
Ein Kind, das längst selbst im eigenen Chaos stand, mit einem Herzen voller Fragen, mit viel mehr Verwirrung, als ich je zeigen konnte.
Ja, sie wuchs in Armut auf.
Aber sie hatte beide Eltern.
Und sie wusste – trotz aller Entbehrungen – wo sie hingehörte.Ich dagegen lebte in der Schwebe. Zwischen Orten. Zwischen Menschen. Zwischen Zugehörigkeiten.
Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, hat mich mein ganzes Leben begleitet.
Es saß in mir wie ein dunkler Schatten hinter der Brust – still, unsichtbar, aber immer spürbar.
Erst viel später, nach vielen Jahren, habe ich begriffen:
Mein Herz ist mein Zuhause. Und je schneller ich lerne, mit mir selbst klarzukommen,
je schneller ich verstehe, dass ich mir selbst genüge,
desto schneller kehrt Frieden ein. Und Freude.
Vielleicht kein lautes Glück. Aber ein leises, tragendes.Ich erinnere mich an sie in Momenten, in denen sie weinte.
Dann kam der Zorn meiner Mutter – unbarmherzig, gerichtet gegen jeden, der ihr wehgetan hatte.
Sie war die Kleinste, das Lieblingskind der Familie.
Und sie wusste es.
Oft spielte sie dieses Privileg aus,
inszenierte eine verletzte Miene, eine kleine Dramatik,
damit ich oder meine Geschwister die Konsequenzen trugen.
In meiner Erinnerung war sie das verwöhnte Baby, eine „Zicke“,
für die sich alles zu drehen schien.
Heute, aus der Rückschau, sehe ich, wie sich das alles geformt hat –
wie wir alle auf unsere Weise versucht haben zu überleben,
wie sich unsere Charaktere aus Schmerz und Schutz entwickelten.
Mein Vater hatte eine engere Verbindung zu ihr,
denn sie wuchs bei ihm auf.
Ich war oft die Schuldige,
diejenige, die angegriffen wurde.Vielleicht, weil ich laut war, weil ich da war,
weil ich mit meinem Licht zeigte,
dass nicht alles richtig war.
Dass sie Fehler gemacht hatten.
Dass ich anders war.
Und dieses Anderssein hat sie alle getriggert.Weil es diesen Unterschied immer gab, zeigte er sich auch in der Schule – im Außen, in der Art, wie wir uns präsentierten, und wie wir mit Menschen umgingen.
Jede von uns versuchte auf ihre eigene Weise, die Wunden der Kindheit zu überwinden.
Eine dieser Wunden war ich. Nicht, weil ich etwas Falsches getan hätte,
sondern weil allein meine Existenz ein Trigger war.Ich weiß nicht, ob sie dachte, dass mir alles leichter gefallen sei, weil ich immer satt und sauber war, oder weil ich nicht im Dreck aufgewachsen bin.
Doch die Wahrheit ist: Bis ich vier Jahre alt war, habe ich im gleichen Haushalt gelebt.
Wer sich mit Kinderpsychologie auskennt, weiß, dass die ersten sieben Jahre die prägendsten für die Entwicklung eines Kindes sind.
Und genau in der Mitte dieser Zeit, mit vier Jahren, erlebte ich einen tiefen Bruch: Ich wurde weggegeben. Von da an musste ich zwei Welten beobachten, fast wie Parallelwelten...Dieser Wendepunkt hat mein Leben grundlegend verändert.
Und all das, was danach kam, kann man nicht einfach mit „leicht“ oder „einfach“ beschreiben. Denn wahre Stärke wächst oft aus den tiefsten Wunden.
Je mehr ich gelobt wurde, desto mehr wuchs irgendwo tief in ihr – unbewusst – ein Schwesterhass gegen mich.Wahrscheinlich würde sie es nie zugeben, wenn sie diesen Text überhaupt liest.
Doch in den letzten Jahren hat sich oft gezeigt, dass meine Entwicklung, mein Weg und mein Leben sie sehr oft triggern.
Besonders, wenn andere Menschen sie nach mir fragen.
Es geht nicht immer darum, sie gegen mich aufzuhetzen.
Oft ist es sogar ein Lob, das mir entgegengebracht wird – für den Weg, den ich gegangen bin.
Und genau das schmerzt.
Deshalb war ich ihr nie böse dafür, wie sie sich fühlte. Ich wusste, woher es kam.
Und ich spürte, dass vieles davon eine fremde Energie war, die sich in ihr eingenistet hatte – besonders, weil sie immer eng befreundet war mit Menschen, die mich nicht mochten.
Es ist ein komplexes Geflecht aus Verletzungen, Loyalitäten und tiefen seelischen Dynamiken. Und ich nehme es an – mit Mitgefühl für uns alle.Und doch – wir beide hatten so vieles gemeinsam, wenn es um unsere Kindheit ging.
Vor allem darin, wie unsere Mutter uns bewusst ungepflegt ließ.
Wie wenig Fürsorge da war. Wie wenig echte, nährende Nähe.
Mir wurden oft Geschichten erzählt.
Zum Beispiel, dass ich als Baby immer nur auf dem Arm meiner Mutter einschlief – und sofort aufwachte, sobald sie mich in mein Bettchen legte.
Es passierte immer wieder.
Bis mein Großvater irgendwann bemerkte, dass etwas nicht stimmte.
Denn die Matratze, auf die sie mich legte, war nass.
Feucht vom Urin, den sie nicht gewechselt hatte.
Und jedes Mal, wenn sie mich in diese Nässe zurücklegte, wachte ich auf.
Kannst du dir vorstellen, was das mit einem Baby macht?Was es bedeutet, wenn die eigene Mutter keine Fürsorge zeigt?
Keine liebevolle Aufmerksamkeit?
Nicht einmal ein normales, sauberes Gefühl von Geborgenheit?
Ich wurde – als Baby – regelrecht trainiert, mich mit dem Geringsten zufriedenzugeben.
Mit dem, was eigentlich niemand verdient.
Und das hat sich tief in mein kindliches Bewusstsein eingebrannt.
Psychologisch ist es längst bewiesen:
Die Verbindung zwischen Mutter und Kind ist grundlegend – besonders, wenn es um Selbstliebe geht.
Wenn genau dort, wo eigentlich Wärme sein sollte, Kälte spürbar ist…
dann lernt ein Kind sehr früh, sich selbst gering zu schätzen.
Nicht bewusst. Sondern leise.
Im Nervensystem. Im Zellgedächtnis. In der Seele.
Es gibt viele Geschichten, die auch meine Schwester erlebt hat.
Eine davon ist besonders tief in mir geblieben.Sie war nur ein paar Monate alt, als sie einmal allein zu Hause gelassen wurde – mit einer Decke über dem Gesicht.
Zufällig kam meine Großmutter vorbei.
Sie hörte ein leises Stöhnen, suchte, und fand meine Schwester in ihrem Kinderwagen.
Sie zog das Kissen zurück – wir wurden als Babies mit einem Kissen zugedeckt, damit wir uns nicht bewegten und ganz still lagen.
Diese Erfahrung war für uns mehr als eine körperliche Einschränkung. Es war ein Moment, in dem wir unsere Freiheit verloren und ein tiefes Gefühl von Ohnmacht und Kontrollverlust spürten. Ein schweres Kissen auf unserer kleinen Brust – das bedeutete nicht nur körperliche Enge, sondern auch das Gefühl, nicht gehört, nicht gesehen und nicht geschützt zu sein.
Solche frühen Erlebnisse hinterlassen oft unsichtbare Spuren in unserer Psyche:
Sie können Ängste und innere Blockaden erzeugen, die sich durch das ganze Leben ziehen. Das Vertrauen in uns selbst und in andere wird erschüttert, die Fähigkeit, Freiheit und Sicherheit zu spüren, wird beeinträchtigt.Ihr Gesicht war völlig nass – vom eigenen Atem, vom Schwitzen, vom Kampf.
Sie war fast erstickt.
Wahrscheinlich fehlten nur wenige Minuten.War es Gedankenlosigkeit?
Oder schon etwas anderes?
Man weiß es nicht.
Aber eins war klar: Man konnte unserer Mutter nichts anvertrauen.
Meine ältere Schwester erzählte oft, dass sie im Laufe ihres Lebens immer wieder Menschen begegnet ist, die ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster zeigen – ein Muster, das uns noch aus unserer Kindheit bekannt war.
Was genau diese „Diagnose“ ist, lässt sich heute nur erahnen…Es ist nicht so, dass sie böse war, sondern dass ihre eigene Verletzlichkeit und Unsicherheit ihr Handeln bestimmten. Sie wurde nie untersucht. Aber das musste auch niemand.
Man fühlte es.
Auch mit einem ungeschulten Blick.Mein Vater hat sie oft „полоумная“ genannt, was so viel bedeutet wie halb-verstandesfähig. Ich habe oft gesehen, wie sie deswegen weinte. Das zeigt, wie sehr sie darunter litt und wie zerbrechlich ihre innere Welt war. Sie konnte aber auch so wütend werden, dass sie meinen Vater schlug – mit einer Kraft, die er oft an blauen Flecken spürte. Körperlich war sie unglaublich stark, eine Stärke, die wir alle von ihr geerbt haben.
Vielleicht sieht man es uns nicht sofort an, doch in unseren Körpern steckt eine große Kraft, die manche Männer durchaus neidisch machen könnte.
Und so wuchsen wir alle irgendwie heran – nicht umsorgt, sondern eher überlebt.
Ein Dasein, das mehr vom „Durchkommen“ als vom „Geborgensein“ geprägt war.Ja – ich hatte ähnliche Erfahrungen. Bei mir wurde es irgendwann besser, äußerlich.
Aber innerlich blieb ein anderes Trauma zurück. Eines, das sich lange in meinem Leben gezeigt hat – still, aber spürbar.Was ich damit sagen will: Wir kamen aus derselben Familie. Von denselben Eltern.
Und jede von uns hatte ihre eigene Wunde zu tragen.Und doch – ich war die, die gehasst wurde.
Nicht, weil ich etwas getan hätte.
Sondern weil ich anders war – und es ohne Scham präsentierte.
Weil ich mich von klein auf bemüht habe, immer besser zu werden.Ich gehörte nie wirklich dazu. Nicht damals. Und auch heute nicht.Und weißt du was?
Heute bin ich sogar dankbar dafür.
Denn dieser Weg des Nicht-Dazugehörens hat mich gelehrt, klar zu wählen.
Ich bin selektiv geworden.
Mit meiner Umgebung.
Mit den Menschen, die ich in mein Feld lasse.
Nicht aus Trotz.
Sondern aus Achtung – vor mir selbst.
Und so verließen wir Kasachstan. Ich – ohne meine Geschwister.
Nur mit meiner Großmutter. Und mein Vater.
Ein Teil der Familie blieb zurück.
Ein Teil meines Herzens auch.
Der 1. Dezember 2000 war der Tag, an dem wir unser Dorf in Kasachstan verließen. Ich erinnere mich bis heute sehr klar an diesen Tag. Für mich war er erfüllt von Vorfreude – endlich durfte ich die alte Welt hinter mir lassen. Ich war immer ein Mensch, der dem Neuen entgegengeht, geführt von der Sehnsucht nach Veränderung. Doch damals war es das erste Mal, dass ich wirklich alles Vertraute zurückließ, und ich hatte keinerlei Erfahrung darin. Und doch überwog in mir die Freude – sie war viel stärker als jede Traurigkeit. Ja, für einen kurzen Augenblick tat es weh, als ich mich von meinen Schwestern verabschiedete. Aber die Aufregung über das neue Leben war so kraftvoll, dass dieser Schmerz sanft in den Hintergrund trat. Wir machten uns damals gemeinsam mit den Kindern meiner Großmutter und ihren Familien auf den Weg. Nicht mit dem Flugzeug, sondern mit dem Bus. Flugtickets für uns drei – meinen Vater, meine Großmutter und mich – konnte sie sich nicht leisten. Das, was ihr nach dem Verkauf des Hauses und unseres bescheidenen Besitzes geblieben war, war sehr wenig, und einen Teil davon wollte sie für die ersten Schritte in der neuen Lebensphase zurückhalten. Also entschieden am Ende alle: Wir fahren mit dem Bus. Drei Tage unterwegs zu sein war ermüdend und zugleich unglaublich aufregend – besonders für uns Kinder.
Die Route führte durch Russland, Belarus und Polen. Im Bus waren viele andere Aussiedler. Manche hatten so viel Essen dabei, dass der ganze Bus vom Geruch nach gekochtem Huhn und Schweiß durchzogen war. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich neben einer Frau saß. Irgendwann, im Schlaf, legte ich unbewusst meinen Kopf auf ihre Schulter. Als ich erschreckt aufwachte, wollte ich ihn sofort zurückziehen – doch sie ließ mich still weiter schlafen. Diese kleine Geste hat sich tief in mein Gedächtnis eingeprägt: ihre Bereitschaft, mich zu tragen, ohne ein Wort zu sagen. Meine Großmutter litt auf der Fahrt an stark geschwollenen Beinen – mehr als wir alle. Ich weiß noch, dass man das sogar bei unserer Ankunft in Friedland erwähnte. Zum Glück ging die Schwellung bald zurück.
Und schließlich kamen wir an: Friedland – ein Ort, den alle Aussiedler kennen und mit dem jeder seine eigenen Erinnerungen verbindet. Für mich war es etwas Wunderschönes. Zum ersten Mal sah ich ein anderes Land: fremde Häuser, Zäune, Straßen und Bäume. Alles war anders – und alles schien mir viel besser als das, was ich zuvor kannte. Ich war überwältigt davon, wie sehr sich die Welt von dem unterschied, was mir vertraut gewesen war. Es war, als hätte sich eine Tür geöffnet – eine Tür in eine neue Welt, die darauf wartete, entdeckt zu werden. Wir blieben dort ungefähr eine Woche – genau weiß ich es nicht mehr, die Erinnerungen sind verschwommen. Aber ich weiß noch sehr gut, wie aufregend alles war – einfach, weil es neu war. Wir lernten ein paar Menschen kennen und verbrachten unglaublich viel Zeit mit unseren Cousinen. Für uns, damals Jugendliche, war es eine besondere, fast blendende Zeit.
Es gab sogar einen Moment, in dem ich mich mit einer Cousine zerstritt. Bis heute habe ich keine Ahnung, weshalb es dazu kam und wer begann. Ich erinnere mich nur, dass sie plötzlich sehr aggressiv wurde und mich schlagen wollte – und ich stellte mich vor sie, bereit, mich zu wehren. Eine andere Cousine, die es immer genoss, Öl ins Feuer zu gießen, war an diesem Tag ganz in ihrem Element. Deshalb wundere ich mich bis heute, warum es am Ende nicht zu einer echten Prügelei wurde. Stattdessen blieb es bei einer heftig geführten, verbalen Auseinandersetzung. Heute, im Rückblick, sehe ich ein Muster, das sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht: Schon früh hatte ich Schwierigkeiten mit Mädchen – in diesem Fall sogar mit leiblichen Verwandten. Ein Thema, das immer wieder in mein Leben zurückkehrte.
Erst viel später, während meiner Ausbildung in der Numerologie, konnte ich verstehen, welche Rolle genau diese Erfahrungen spielten. Kinder, die im Februar geboren sind, begegnen oft schon von Kindheit an komplexen Themen in ihrer weiblichen Ahnenlinie. Ihre Aufgabe ist es, diese Muster zu durchbrechen und zu heilen. Oft bedeutet das, dass sie viel Zeit bei den Großmüttern verbringen und schwierige Beziehungen zur Mutter oder zu Schwestern haben. Mir wurde klar, warum es in unserer Linie so viel Neid, Missgunst und verborgene Konflikte zwischen Frauen gab. Ich erkannte: Diese Seelen entschieden sich, mir als Auslöser zu begegnen, damit ich bewusst auf meine Ahnenthemen blicken und sie heilen konnte. Meine Seele wählte diesen Weg…
Nach einer Woche in Friedland wurden wir nach Wolfsburg geschickt. Die Kinder meiner Großmutter wurden auf benachbarte Städte verteilt. So sehr sie auch bat, dass wir alle an einem Ort bleiben dürften – dieser Wunsch wurde ihr nicht erfüllt. Und sie erinnerte sich bis zuletzt daran, nahm es jener Frau übel, sprach über sie, kehrte immer wieder zu ihrer Kränkung und ihrem Zorn zurück. Leider war auch dies eine Qualität, die sich durch ihr ganzes Leben zog: Meine Großmutter konnte anderen Menschen schwer verzeihen und vergaß nichts. So wohnten wir – meine Großmutter, mein Vater und ich – mehrere Wochen bei der Schwester meiner Großmutter. Die anderen wurden vorübergehend in Unterkünften untergebracht, bis sie eigene Wohnungen erhielten.
Die ersten Tage in Wolfsburg waren für mich voller Aufregung und Neugier. Alles war neu: die Produkte in den Läden, das ungewohnte Essen, das lebendige Stadtleben, so anders als bei uns auf dem Land. Besonders freute ich mich über die Toilette in der Wohnung – etwas, das ich zuvor nur aus Filmen kannte. In unserem Dorf konnten sich das nur wenige Familien leisten, und solche galten als wohlhabend. Für uns war es normal, draußen zur Toilette zu gehen oder nachts den Eimer im Haus zu benutzen, den man morgens hinter den Schuppen brachte. Gerade solche Kleinigkeiten, scheinbar ganz alltägliche Details, versetzten mich in echte Begeisterung. Man kann sagen, dass das Materielle, der Hauch von Luxus und Bequemlichkeit schon damals eine besondere Anziehungskraft auf mich ausübten. Alles Neue und Ungewohnte erfüllte mich mit Freude und Neugier, die stärker waren als jede Wehmut über das Vergangene.
ch erinnere mich gut an meine erste Schule in Deutschland. Es war eine Realschule im selben Viertel, in dem wir damals lebten. Nach meinen Noten hätte ich auch aufs Gymnasium gehen können. Aber da ich kein Englisch konnte – die erste Fremdsprache am Gymnasium –, entschied man, mich auf die Realschule zu schicken. Dort wurde Russisch als Fremdsprache angeboten. So wurde meine Muttersprache plötzlich zum „Fremdsprachenfach“. Heute kommt mir das fast absurd vor. Die Entscheidung über meine Schule traf nicht ich, nicht einmal meine Großmutter. Sie sprach nur Plattdeutsch und konnte solche Angelegenheiten nicht regeln, deshalb übergab sie die Verantwortung einer entfernten Verwandten. So entschied die Tante, dass für mich die Realschule „ausreichend“ sei und nicht das Gymnasium. Viele Jahre später begriff ich, dass man hätte einen Nachhilfelehrer nehmen können, um Englisch zu lernen, dass man es auch an der Abendschule hätte lernen können. Genau das begann ich dann mit 18 Jahren zu tun…
Ich verstand, dass wir im Leben nicht immer die volle Unterstützung erhalten, auf die wir hoffen. Doch gerade darin verbirgt sich ein Geschenk: die Kraft, den eigenen Weg selbstbewusst und eigenständig zu gehen.
So wechselte ich nach dem erfolgreichen Abschluss der Realschule aus eigener Kraft ins Gymnasium. Heute weiß ich: Jede sichtbare Grenze führte mich nur tiefer in meine eigene Stärke.
Die Schulzeit war insgesamt recht angenehm. Ich erlebte nie Spott oder Ablehnung nur deshalb, weil ich nicht aus Deutschland stammte. Dort lernten viele Aussiedler und Kinder von Migranten, und gerade das machte jedes Kind auf natürliche Weise angenommen. Ich hatte darin Glück. Unter den russischsprachigen Jugendlichen fand ich schnell Freunde. Man nahm mich in ihre Kreise auf, und die meiste Zeit verbrachte ich mit ihnen. Das gab mir Halt und ein Gefühl von Zugehörigkeit, bis ich ins Gymnasium wechselte.
Schon damals wusste ich, dass ich an die Universität wollte. Damals träumte ich von Architektur, weil ich mir nichts vorstellen konnte, das zugleich so kreativ und so angesehen war. Meine Entscheidungen wirkten reif, doch ich bewegte mich noch unbewusst – als ginge ich in eine Dunkelheit, in der ich erst später das Licht unterscheiden lernte.
Am Ende gehörte ich zu den besten Schülerinnen unter allen vier zehnten Klassen. Natürlich waren meine Noten schwächer als in Kasachstan, wegen meiner noch fehlenden Deutschkenntnisse, aber sie reichten völlig aus, um ins Gymnasium aufgenommen zu werden – und gleich in die 11. Klasse.
Ich erinnere mich gut an den Moment, als ich nach der Ehrung als eine der Besten von der Bühne hinabstieg und der Direktor zu der Reihe ging, in der meine Großmutter saß. Er schüttelte ihr die Hand und dankte ihr dafür, dass sie eine so wunderbare Enkelin großgezogen habe, die es in nur zwei Jahren in Deutschland unter die Besten geschafft habe. Für meine Großmutter war das ein besonderes Zeichen der Anerkennung. Dieser Augenblick grub sich so tief in ihr Herz, dass sie sich noch viele Jahre später mit Stolz und Freude daran erinnerte. Es war ihr besonders teuer, eine solche Anerkennung fern der Heimat, in einem neuen Land, zu erleben.
Bevor ich von meinem Weg im Gymnasium erzähle, möchte ich etwas über meine Beziehung zu meinem Vater teilen. Mit dem Umzug nach Deutschland mussten wir in einer Wohnung zusammenleben – und ich sah mit eigenen Augen, dass er auch hier weiter trank. Der Staat zahlte ihm alle Bezüge, einschließlich meines Anteils, damit er unseren Lebensunterhalt sicherte. Aber er gab diesen Teil nie an meine Großmutter weiter, und sie war es, die mein Leben trug, während er dem Alkohol nachging. Die Nächte waren oft von Schreien erfüllt. Er brüllte, schimpfte, erbrach sich so laut, dass wir nicht schlafen konnten, lief manchmal nackt durch die Wohnung, und am Morgen behauptete er, es sei nie geschehen, und nannte uns Lügnerinnen. Wer mit Alkoholikern zu tun hatte, weiß, wie eng sich in ihrer Welt Wahrheit und Lüge verweben.
Am meisten verletzte mich, dass er plötzlich versuchte, in meine Erziehung einzugreifen. Ich war damals 15 oder 16 Jahre alt – und jeder Respekt vor ihm war bereits verschwunden. Die Vergangenheit, unsere ständigen Streitereien und Prügeleien, das, was er nun auch in Deutschland fortsetzte – all das ließ keinen Raum für Vertrauen. Wir stritten, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, und oft wurde die Toilette zu meiner einzigen Rettung, in der ich mich vor ihm einschloss. In seiner Wut riss er einmal sogar den Türrahmen heraus, um zu mir zu gelangen. In jener Zeit begriff ich, dass ich mich vor meinem eigenen Vater schützen musste – so, wie es niemals sein sollte. Ein Vater sollte ein Beschützer sein. In meiner Geschichte jedoch war er ein Angreifer, einer, der mich provozierte, um mir Energie zu entziehen. Und er tut es bis heute – nur bin ich jetzt stark und bewusst genug, ihm nichts zu geben. Wenn er in Raserei geriet, begann er, sich in die Hände zu beißen. Seit Kindheit lebte er mit einem nervlichen Leiden, mit dem er geboren wurde. In solchen Momenten schien es, als dränge ein Dämon aus seinem Körper, der sich auf mich stürzen wollte. Meine Reaktion darauf – damals fast die einzige – war völliger Ekel, eine Gegenwehr auf sein Wahnsinniges. Biergläser, Teller – alles, was ihm in die Hände fiel, flog. Der Grund war immer derselbe: Er verlangte Respekt, den ich ihm nicht mehr geben konnte.
Es war, als wolle er mir plötzlich die väterliche Rolle aufzwingen, die er nie ausgefüllt hatte. Mein innerstes Wesen rebellierte dagegen. In solchen Momenten wurde ich buchstäblich von einem Gerechtigkeitssinn erfüllt, den ich viele Jahre in mir getragen hatte. Ich hungerte nach Wahrheit und konnte mich nicht fügen, wenn Menschen Aufmerksamkeit und Respekt forderten, obwohl sie selbst keines von beidem zeigten – im Gegenteil, gegenteilig handelten. Hinzu kam, dass meine Großmutter im fremden Land noch ängstlicher wurde. Für mich bedeutete das noch mehr Einschränkungen und Verbote. Ich wollte Sport treiben, ein Hobby haben, mich entwickeln, doch oft wurde mir das verwehrt – teils wegen des Geldes, teils wegen ihrer Ängste.
Wir lebten zu dritt – drei Generationen in einer Wohnung, jede mit ihrem eigenen Charakter. Und mittendrin war ich, hungrig nach einem anderen Leben. Heute verstehe ich, dass es nicht nur die Lust auf Neues war, sondern ein tiefes Streben nach Freiheit, der Wunsch, aus dem Käfig auszubrechen. Damals hatte ich einige Freundschaften, aber keine davon ergriff mich ganz.
Es war eine Phase, in der ich mich in einer Entwicklung befand, die ich selbst noch nicht verstand, und in der ich viele ungesunde Muster übernahm. Weil mir weder die Großmutter noch der Vater Geld gaben, begann ich, bei Freunden zu leihen. Wenn man mich irgendwohin einlud und ich nicht gehen konnte, bat ich sie um Unterstützung. Ich wusste oft nicht, wie ich zurückzahlen würde, und doch gelang es mir immer irgendwie. Manchmal schenkte man mir Geld, manchmal half man mir anders, und ich konnte meine Schulden begleichen. Mein Vater gab mir damals 50 Euro „Taschengeld“. Für ihn reichte das – für Essen, Kleidung, Schulsachen und all meine Ausgaben. In Wirklichkeit sorgte jedoch meine Großmutter für all das. Vaters Geld war eher Symbol als echte Unterstützung. So lernte ich früh, Geld zu leihen – und ich begriff, dass es funktioniert, solange man zurückzahlt. Genau damals prägte sich in mir ein schweres Muster im Umgang mit Geld ein: Abhängigkeit, tief in unserer Familie verwurzelt. Während einer im Stamm mit Alkohol rang, trug ich die Last des Geldes.
Zugleich suchte ich Wege, unabhängiger zu werden. Mein Vater vertrank die Bezüge, die der Staat für mich zahlte. Das war unerträglich, und ich fasste den Entschluss: Ich will ihm diese Möglichkeit nehmen. So begann ich, an Wochenenden im Volkswagen-Werk zu arbeiten. Viele Schüler jobben dort, indem sie neue Autos reinigen. Für mich war es weit mehr als ein Nebenjob. Es war meine bewusste Entscheidung – auf eigenen Beinen zu stehen und meinem Vater das für mich bestimmte Geld zu entziehen. Und tatsächlich: Kaum hatte ich begonnen zu arbeiten, wurden die Zahlungen, die er gewohnt war für mich zu erhalten, eingestellt. Er explodierte vor Wut…
Die Arbeit wurde zu einer wertvollen Schule, auch wenn sie Zeit von meinem Lernen nahm. Aber sie gab mir das erste Gefühl von Selbstständigkeit und die Kraft, zu erkennen, dass ich mein Leben aktiv gestalten kann – trotz schwerer Umstände. Viele Jahre später, bereits im Numerologie-Studium, verstand ich, warum sich all das so stark zeigte. Es war nicht einfach „mein persönliches Problem“, sondern ein Ahnenthema. In unserer Linie traten Abhängigkeiten immer wieder auf – bei dem einen Alkohol, beim anderen Geld. Meine Seele wählte, da hindurchzugehen, um es zu erkennen, zu durchbrechen und zu heilen. Heute sehe ich klar: Was wie Schwäche schien, wurde in Wahrheit zum Beginn meiner Heilarbeit – für mich und für die ganze Linie.
Im Gymnasium begegnete ich meiner zukünftigen besten Freundin. Sie sprach mich im Russischunterricht an – ja, ich lernte weiterhin Russisch als Fremdsprache, und das war das einzige Gymnasium, das mich ohne Englischkenntnisse aufnahm. So entstand eine enge Freundschaft. Sie war eine leuchtende, interessante Persönlichkeit, und wir verstanden uns sofort großartig. Schon am ersten Tag stellte ich sie auf ein Podest. Mit der Zeit entwickelte sich zwischen uns eine Dynamik, in der ich häufiger die Rolle der Folgenden einnahm und sie die dominante Position. Damals war ich unsicher, zu nachgiebig. Wir verbrachten elf wunderbare Jahre miteinander – voller Freude, Nähe und unvergesslicher Momente. Aber es war auch eine Phase meines Lebens, in der ich lernte, mich selbst besser zu verstehen.
Inzwischen wurde der Druck zu Hause immer stärker. Ich konnte es nicht länger ertragen. Mein Vater drehte durch, meine Großmutter kontrollierte immer mehr, und ich hungerte nach Leben. Ich war immer pflichtbewusst: lernte gut, half zu Hause, hatte nie mit Drogen oder ähnliches zu tun… Doch mein Wunsch nach Freiheit wurde ständig abgewiesen. „Kein Geld, dir passiert etwas…“ – so lauteten die Antworten. Am meisten zermürbte mich jedoch das Leben mit meinem Vater und die ständigen Verbote meiner Großmutter. Ich konnte dieses Tollhaus nicht länger ertragen – seine Ausbrüche, ihre Ängste, die Begrenzungen… Also wandte ich mich an die Jugendhilfe. Ich wollte eine eigene Wohnung. Doch meine Situation wurde nicht als „extrem“ eingestuft. Auch mein Vater wurde eingeladen, und wie immer spielte er seine Rolle perfekt: zu Hause der Teufel, nach außen der Engel. Man glaubte ihm mehr als mir. Nach außen wirkte er wie ein fürsorglicher Vater, und mich sah man als schwierige Jugendliche. Ich erhielt keine Hilfe…
Doch ich gab nicht auf. Ich suchte immer wieder Unterstützung, und am Ende gelang es mir über den Sozialamt. Nach mehreren Versuchen genehmigte man mir einen Betrag, mit dem ich ein Zimmer mieten konnte. So zog ich mit 19 aus. In der Nähe der Schule fand ich ein Reihenhaus, in dem Zimmer vermietet wurden, und eines davon wurde meines. Meiner Großmutter sagte ich es erst am Abend, am Tag des Umzugs. Ich wusste warum: Hätte ich es früher gesagt, hätte sie mich bis zuletzt „zuredegewaltigt“. Schon damals hatte ich ein feines Gespür für Menschen. Ich konnte ihr ständiges Nörgeln und jene negative Energie, die auch eine ihrer Kräfte war, nicht aushalten. Meine Großmutter konnte manipulieren, auf Gefühle drücken – und in so einer Situation wäre es für mich sehr schwer gewesen. Ich wollte mich nicht in eine Lage bringen, in der man mich „bearbeitet“, also beschloss ich zu schweigen bis ganz zum Schluss. Deshalb hielt ich es tatsächlich bis zum allerletzten Moment geheim. Und erst, als die Dinge gepackt waren und es kein Zurück mehr gab, sagte ich es ihr. Ich erinnere mich, wie schwer es für sie war. Später erfuhr ich von einer Cousine, dass meine Großmutter weinte und ihre Kinder anrief, um zu sagen, dass ich ausgezogen sei. Bis heute schmerzt es, zu spüren, wie tief sie das verletzte – den Menschen, der mich je am meisten liebte…
Selbst Jahre später behauptete sie, ich sei nur wegen meiner Freundin ausgezogen – dass gerade sie mich verändert habe. In Wahrheit war die Freundin nur ein Teil des Puzzles. Sie zeigte mir, dass das Leben anders sein kann, und an ihrer Seite konnte ich Neues ausprobieren. Doch die Entscheidung, das Zuhause zu verlassen, entsprang meinem inneren Drang – dem Durst nach Freiheit und dem Wunsch, meinen eigenen Weg zu gehen. Es war meine erste große Entscheidung – die Entscheidung, mich selbst zu wählen. Ich brauchte Stille, Frieden, einen Raum ohne Streit und Druck. Und selbst wenn meine Großmutter mir das nicht geben konnte, wusste ich: Ich kann es mir selbst schenken. Es war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Damals erkannte ich: Wir entscheiden unser Schicksal selbst. Ja, Entscheidungen können schwer sein, und ihre Folgen können wehtun. Doch am Ende liegt es in unseren Händen, das zu wählen, was für unsere Seele am besten ist.
So wurde mein Umzug zum Beginn eines neuen Kapitels. Zum ersten Mal lebte ich in meinen eigenen vier Wänden, frei vom Geschrei und vom Druck zu Hause. Ich setzte meine Schulzeit am Gymnasium fort und arbeitete, um für mich zu sorgen. Die Miete wurde zunächst übernommen, bis ich mehr verdiente. Ich jobbte in einer Eisdiele und hatte mein eigenes Geld. Es war der Beginn eines neuen Lebens – eines Lebens, das nicht immer leicht war, aber endlich wirklich meines.
Als ich auszog, begann ein neues Leben für mich. Es fühlte sich ungewohnt an – ein wenig ängstlich, auf einmal allein in einem Zimmer zu sein, allein zu leben, mit all der Verantwortung, die plötzlich auf meinen Schultern lag. Ich war noch sehr jung, aber ich nahm alles mit einem offenen, positiven Geist an. Ich träumte von einer weiten Zukunft, in der mir die Welt zu Füßen lag.
Meine Leistungen am Gymnasium waren nie besonders gut. Irgendwie schaffte ich es jedes Jahr, versetzt zu werden… Damals empfahlen mir viele, die 11. Klasse sie zu wiederholen.
Man sagte mir, dass es sonst kaum möglich wäre, das Abitur zu schaffen, wenn die Noten gerade so zum Weiterkommen reichten. Ich hörte auf diesen Rat. Ich hatte niemanden in meiner Familie, der mir etwas empfehlen oder zeigen konnte, denn niemand war bisher so weit gekommen.
Und ja – meine Leistungen waren nicht die besten, aber sie waren gut genug, um am Gymnasium zu bleiben. In einigen Fächern, besonders in Italienisch, war ich sogar sehr gut. Sprachen lagen mir immer. Doch in allem anderen tat ich mich schwer – aus vielen Gründen.
Einer der Gründe, warum ich mich in der Schule so schwer tat, war die Sprachbarriere. Ich war schüchtern geworden, meldete mich kaum mündlich.
Und wer das deutsche Schulsystem kennt, weiß, dass die mündliche Note oft sechzig Prozent zählt – die schriftliche nur vierzig.
So war ich schriftlich vielleicht durchschnittlich, aber mündlich – ein Desaster. Nicht, weil ich nichts wusste, sondern weil ich unsicher war.
Jemand, der früher lebendig und offen war, wurde plötzlich leise.
Ich hatte Angst, Fehler zu machen, Angst, ausgelacht zu werden, wenn ich etwas Falsches sagte.
Ich war irritiert, wie selbstverständlich andere mit Stolz und Lautstärke ihre Meinung äußerten – ob sie richtig war oder nicht, spielte kaum eine Rolle.
Hauptsache, man war laut, selbstsicher.
Dafür wurde man gelobt – nicht unbedingt für das, was man sagte. Das erschütterte mein Selbstbewusstsein tief.
Doch genau dort begann etwas Neues.
Diese Unsicherheit war der Anfang meiner inneren Reise – mich selbst kennenzulernen, meine Schwächen zu verstehen und meine Stärken zu entdecken.
Viele Jahre später verstand ich, dass meine Schüchternheit nicht nur aus Unsicherheit kam – sondern aus Scham.
Ich schämte mich für meinen Akzent.
Er war wie ein leises Zeichen meiner Herkunft, das mich immer verriet. Ich wollte dazugehören, „richtig“ klingen, so wie alle anderen.
Erst in Kanada begann sich das langsam zu lösen.
Ich investierte in Logopädie, um meinen deutsch-russischen Akzent zu minimieren. Und tatsächlich – solange ich im Raum des Logopäden saß, klang ich fast makellos. Doch sobald ich hinausging, in den Alltag zurückkehrte, kam mein Akzent wieder.
Ich konnte ihn nicht kontrollieren – und irgendwann verstand ich, warum: Er war nicht mein Fehler. Er war ein Teil von mir.
Heute weiß ich: dieser Klang in meiner Stimme ist mein Abdruck, meine Geschichte. Man hört in jeder Sprache, die ich spreche, dass ich noch andere Sprachen in mir trage. Und genau das ist schön.
Ich würde es für nichts auf der Welt eintauschen.
Mein Akzent ist geblieben – doch meine Scham ist verschwunden.
Denn ich habe verstanden, dass man nicht angenommen wird, wenn man versucht, allen zu gefallen.
Man verliert sich selbst, wenn man sich anpasst, um „richtig“ zu wirken.
Ich habe aufgehört, meine Stimme zu verstecken.
Sie trägt meine Wurzeln, meine Erfahrungen, mein ganzes Sein. Und das, was ich dadurch gewonnen habe, ist unbezahlbar.
Das hier ist ein kleiner Appell:
Ja, du bekommst vielleicht nicht immer das, was du dir wünschst, wenn du etwas Neues anstrebst.
Aber manchmal schenkt dir das Leben etwas viel Größeres, als du es dir je erträumt hättest – dich selbst.
Ein weiterer Grund, warum meine schulischen Leistungen schwankten, war meine Arbeit. Oft arbeitete ich nach der Schule noch bis zu sechs Stunden. Ich lebte schon allein, und obwohl es ruhig war, endeten die familiären Streitigkeiten nie – selbst, wenn ich nur zu Besuch war.
Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, die sich tief in mir eingebrannt hat:
Ich brachte einmal meine Wäsche zu meiner Oma, weil es in meinem Zimmer und im ganzen Haus keine Waschmaschine gab. Ich hatte keine andere Möglichkeit, als mit der Hand zu waschen. Also dachte ich, es wäre praktisch, meine Sachen zur Oma zu bringen.
Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, die sich tief in mir eingebrannt hat:
Ich brachte einmal meine Wäsche zu meiner Oma, weil es in meinem Zimmer und im ganzen Haus keine Waschmaschine gab. Ich hatte keine andere Möglichkeit, als mit der Hand zu waschen. Also dachte ich, es wäre praktisch, meine Sachen zur Oma zu bringen.
Doch statt Verständnis erlebte ich eine bittere Enttäuschung. Mein Vater wurde wütend, warf mir vor, ihr Geld zu verschwenden – wegen des Stroms, den die Waschmaschine verbrauchte. Meine Oma versuchte, mich zu trösten. Sie sagte, ich solle nicht auf ihn hören und meine Sachen ruhig bringen. Aber ich war zu stolz. Ich tat es nie wieder.
Diese Szene hat mich tief verletzt. Noch viele Jahre später erinnerte ich mich an diesen Moment – an die Kälte, die ich gespürt hatte, an das Gefühl, wieder einmal allein zu sein.
Von da an brachte ich meine Kleidung in die Reinigung. Das kostete natürlich Geld – also musste ich mehr arbeiten, um es mir leisten zu können. Später kaufte ich mir einen kleinen Eimer und begann, meine Sachen selbst zu waschen, trocknete sie in meinem winzigen Zimmer. Ich kämpfte, so gut ich konnte.
Manche würden vielleicht sagen: „Wenn du schon ausgezogen bist, musst du auch Verantwortung übernehmen.“ Ja natürlich…
Aber darum ging es nicht. Es ging darum, dass ich wieder einmal auf mich allein gestellt war. Es gab keine Situation in meinem Leben, in der ich wirklich Unterstützung von meinen Vater bekam. Im Gegenteil – später im Leben wurde sogar von mir erwartet, dass ich für ihn sorgen sollte.
Es gab noch einen anderen Grund für meine schwachen schulischen Leistungen. Irgendwo, unbemerkt, hatte sich eine Depression in mir eingenistet. Wann sie begann, wusste ich nicht genau. Ich kannte dieses Wort damals kaum – geschweige denn, was es bedeutete. Doch wenn ich heute zurückblicke, glaube ich, dass es mit etwa sechzehn, siebzehn Jahren anfing – in der Zeit, als ich in eine Essstörung, eine Art Bulimie, hineinglitt.
Ich lebte noch mit meiner Familie. Es war die Phase, in der junge Mädchen abnehmen wollen, in der unser innerer Blick sich immer stärker auf Schönheit richtet – auf das Bedürfnis, „gut genug“ zu sein, um geliebt zu werden.
Es ist das Alter, in dem die Psyche langsam lernt, dass Liebe oft an Bedingungen geknüpft scheint: schön sein, angepasst sein, stark sein.
Heute sehe ich so deutlich, wie viele Zeichen es schon damals gab, dass ich lernen musste, mich selbst zu lieben. Doch es gab niemanden in meiner Umgebung, der solche Dinge erkennen oder verstehen konnte. Ich musste alle Phasen meiner inneren Entwicklung ganz allein durchleben. Und natürlich wurde das, was man nicht verstand, bestraft.
Meine Oma bemerkte irgendwann, dass ich nach dem Essen immer auf die Toilette ging. Sie wusste nicht, warum. Ich übergab mich regelmäßig – steckte mir die Finger in den Hals, um das Gefühl der Kontrolle zurückzugewinnen, das mir überall sonst fehlte.
Doch anstatt Hilfe zu bekommen, wurde ich getadelt. Sie warf mir vor, Essen zu verschwenden – und damit Geld.
So kämpfte ich nicht nur mit einem inneren Schmerz, sondern auch mit Schuldgefühlen und Vorwürfen.
Das Schlimmste war, dass bald die ganze Verwandtschaft davon wusste. Ich wurde ausgelacht, beschämt, gedemütigt.
Einmal, als ich für eine Woche bei meinem Onkel zu Besuch war, wurde nach dem Essen die Tür zur Toilette abgeschlossen. Als ich fragte, warum, wurde mein „Problem“ vor allen angesprochen. Ich fühlte mich bloßgestellt – und von meiner Oma verraten.
Es war, als gäbe es in dieser Familie kein Geheimnis, das geschützt blieb. Alles wurde weitergetragen, besprochen, ausgeschlachtet – und irgendwann gegen mich verwendet. Meine „Schwächen“ wurden zum Gesprächsthema, meine Verletzlichkeit zur Schande.
Rückblickend glaube ich, dass genau in dieser Zeit meine Depression wirklich Form annahm.
Damals war mir das alles nicht bewusst. Erst später, als ich auf dem Gymnasium war und der Druck von allen Seiten zunahm, begann ich, Panikattacken zu bekommen – besonders während der Vorprüfungen fürs Abitur.
Meine damalige Freundin erzählte ihrer Mutter davon. Sie meinte, es klinge nach einer Depression, weil ich oft das Gefühl hatte, „unter einer Haube“ zu leben – als wäre alles um mich herum wie ein Traum, unecht, weit entfernt.
Also entschied ich mich, einen Neurologen aufzusuchen.
Doch die Sitzung war enttäuschend. Er hörte mir kaum zu, stellte keine Fragen, streckte nach ein paar Minuten die Hand aus, griff zum Rezeptblock und schrieb mir Antidepressiva auf.
Ich hatte das Gefühl, gar nicht gesehen zu werden – nur abgefertigt zu werden. Ich wurde mit einem Zettel hinausgeschickt, der meine Seele heilen sollte.
Ich nahm die Tabletten zunächst, aber ich wusste tief in mir: Das war nicht der Weg. Nach kurzer Zeit setzte ich sie wieder ab.
Ich erzählte meiner jüngeren Schwester davon – sie war damals schon in Deutschland. Sie lachte mich aus und meinte, ich sei verrückt, wenn ich schon Tabletten nehmen würde. Ich erinnere mich, wie weh das tat. Wie einsam es sich anfühlte, nicht verstanden zu werden – von niemandem.
In jener Zeit machte ich auch meinen Führerschein. Es dauerte lange – mit einer Pause von sechs Monaten, nachdem ich dreimal durch die praktische Prüfung gefallen war. Die Theorie bestand ich ohne einen einzigen Fehler. Doch die Umsetzung beim Fahren fiel mir schwer. Heute weiß ich, dass auch das mit meinem seelischen Zustand zusammenhing – mit der inneren Erschöpfung, dem Druck, den ich damals kaum tragen konnte.
Mein Fahrlehrer war zudem alles andere als freundlich. Er schrie mich oft an, machte mir noch mehr Angst, noch mehr Druck.
Und während ich das jetzt schreibe, wird mir bewusst, wie viele Schichten aus Stress, Angst, Überforderung und seelischem Schmerz ich damals in mir trug – ohne es zu wissen, ohne jemanden, der mir hätte helfen können.
Es war ein langer Weg, bis ich meinen Führerschein endlich in der Hand hielt. So viel Geld, so viele Stunden, so viele kleine Prüfungen – nicht nur auf der Straße, sondern auch im Leben selbst. Am Anfang wollte meine Oma mich nicht unterstützen. Sie sagte, sie würde mir kein Geld dafür geben, und fragte, warum ich das überhaupt machen wolle, wenn ich mir danach doch kein Auto leisten könne. Diese Worte waren nicht wirklich ihre eigenen. Sie waren eingeflüstert – von jemandem aus der Familie, jemandem, der sich, wie so oft, in Entscheidungen einmischte, die eigentlich nur mich betrafen.
Ich sehe das heute mit anderen Augen. Damals verstand ich es nicht, doch heute spüre ich, wie stark die Stimmen anderer meinen Weg mitgeformt haben. Später änderte meine Oma ihre Meinung. Sie half mir – übernahm die Hälfte der Kosten, und ich war dankbar dafür.
Mein Vater trug, wie so oft, nichts dazu bei.
Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, fühle ich beides: Dankbarkeit und dieses leise Ziehen in der Tiefe, wo sich ein Muster zeigt, das sich damals schon abzeichnete. Zu viele Einflüsse von außen, zu viele Menschen, die glaubten, sie wüssten, was richtig für mich sei. Und doch war ich immer diejenige, die – trotz allem – ihren eigenen Weg ging. Vielleicht nicht laut, aber entschlossen.
Heute, viele Jahre später, höre ich manchmal, dass all das gar nicht so gewesen sei. Dass man es anders erinnert. Und jedes Mal spüre ich, wie Wahrheit sich verändert, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man sie betrachtet. Jeder trägt seine eigene Version der Geschichte. Aber meine lebt in mir – leise, klar und wahrhaftig.
Vielleicht ist es genau deshalb, dass ich heute Gespräche anders führe. Ich erzähle meine Seite nicht mehr, um etwas richtigzustellen, sondern um anderen Menschen zu zeigen, dass sie aus meiner Erfahrung auch was im Alltag anwenden können. Ohne Kampf, ohne Verteidigung. Einfach so, wie sie in mir geworden ist. Vielleicht ist das auch der Anfang von Vergebung für dich – nicht nach außen, sondern nach innen.
Natürlich war nicht alles grau in jener Zeit.
Es gab auch viele Momente, in denen ich das Leben spürte, in denen ich lachte, tanzte, träumte. Ich war jung – und all die Reize, die das Jugendalter mit sich bringt, gingen auch an mir nicht vorbei.
Damals begann ich, mich sehr bewusst zu kleiden. Mein selbst verdientes Geld aus der Arbeit in der Eisdiele steckte ich in Kleidung – in kleine Dinge, die mir das Gefühl gaben, dazuzugehören. Ich glaubte, dass mich das schöner machte, vielleicht sogar liebenswerter. Dass ich dadurch ein Stück näher an das herankäme, was „normal“ war.
Und ja – der Satz „Kleider machen Leute“ stimmt auf eine gewisse Weise. Doch sie heilen die Seele nur oberflächlich. Für den Moment. Wirklich genährt wird sie erst dann, wenn wir beginnen, nach innen zu schauen und dort zu investieren.
Aber zu jener Zeit war Mode mein Ventil. Mein Ausweg. Ein Weg, meine inneren Konflikte zu übertönen, indem ich mich nach außen zurechtmachte.
Auch das Feiern gehörte dazu – ab und zu in Diskotheken, manchmal mit einem Drink, manchmal mit einer Zigarette. Ich war nie jemand, der täglich rauchte oder trank. Es war mehr ein Teil des sozialen Dazugehörens, eine Phase, in der man einfach mitmachte, weil es sich normal anfühlte.
So vergingen meine Jahre am Gymnasium – zwischen Schule, Arbeit und kleinen Ausflügen ins Nachtleben, meistens mit meiner besten Freundin an meiner Seite.
Doch das Kapitel endete anders, als ich es mir erhofft hatte.
Ich bestand mein Abitur nicht. Ich fiel in drei Fächern durch – nur in Italienisch, meinem Herzensfach, war ich gut. Eine Woche später hätte ich die Möglichkeit gehabt, Nachprüfungen zu schreiben. Doch ich entschied mich dagegen.
Ich glaubte nicht daran, in einer Woche das aufzuholen, was mir in den vergangenen Jahren entglitten war. Tief in mir wusste ich, dass das Versagen nicht nur mit Lernen zu tun hatte – es hatte mit meinen inneren Verletzungen zu tun, mit der Müdigkeit meiner Seele.
Ich spielte die Coole, um nicht als schwach dazustehen. Ich tat so, als würde es mich nicht berühren – besonders vor meiner besten Freundin. Ich wollte keine Heulsuse sein.
Aber das war ein Fehler.
Ich hätte hingeschaut, gefühlt, verstanden. Doch ich drängte alles weg – wie so oft. Ich hielt es für besser, so zu sein, wie andere mich sehen wollten. Zumindest glaubte ich das damals.
Was für eine innere Blockade daraus entstand, sollte ich erst viel später verstehen. Du kannst es dir vorstellen – was es mit einem jungen Menschen macht, der früher in der Schule immer zu den Guten gehörte, und plötzlich scheitert.
In dieser Zeit geschah etwas, das mir bis heute in Erinnerung geblieben ist.
Eine Verwandte trat mir im Türdurchgang auf den Fuß – scheinbar zufällig, doch es fühlte sich nicht zufällig an.
Etwas in mir wusste, dass da mehr war, auch wenn ich es damals nicht verstand. Ich spürte, dass die Geste eine andere Bedeutung trug, etwas Energetisches, etwas Fremdes. Ich ließ es los, verdrängte das Gefühl, versuchte, mich nicht hineinzusteigern.
Erst viele Jahre später lernte ich, dass solche Handlungen in bestimmten Formen von schwarzer Magie als Ritual verwendet werden – um jemandem den Weg zu versperren, um seine Entwicklung energetisch zu blockieren.
In alten Überlieferungen und magischen Erzählungen gilt das bewusste Betreten oder Stellen auf den Fuß eines Menschen nicht als bloße Geste, sondern als symbolischer Akt. In vielen Kulturen stehen die Füße für den eigenen Lebensweg – für Bewegung, Entwicklung und das Voranschreiten der Seele. Sie tragen uns durch alle Phasen unseres Daseins, durch Freude, Schmerz und Wandlung.
Wenn jemand absichtlich auf den Fuß eines anderen tritt – sei es aus Neid, Macht oder alter Gewohnheit –, kann dies in volkstümlicher Deutung als Versuch verstanden werden, seinen Weg zu blockieren. Ein energetisches Zeichen, das den Fluss des Lebens behindern oder die persönliche Entwicklung bremsen soll.
Solche Vorstellungen finden sich besonders in den alten slawischen Traditionen der Zauberformeln und Beschwörungen, den sogenannten zagovory, aber auch in Fuß- und Spurmagie-Ritualen anderer Regionen.
Überall dort, wo die Erde als Trägerin unserer Wege verehrt wird, galt das bewusste Stören des Schrittes eines Menschen als Eingriff in sein Schicksal – ein Versuch, seine Richtung zu verändern.
Und als ich darüber erfuhr, wurde mir bewusst, dass genau das in jener Zeit geschah, als ich auf dem Gymnasium war – genau dann, als es mir am schwersten fiel, voranzukommen.
Doch jedes energetische Handeln trägt auch sein Gegenbild in sich – das Bewusstsein.
In dem Moment, in dem ich verstand, dass damals etwas gegen meinen Weg gerichtet war, begann sich in mir etwas zu lösen. Es war, als hätte ich endlich das Muster erkannt, das mich so lange unsichtbar gehalten hatte.
Mit Licht, mit Aufmerksamkeit und innerer Klarheit durfte ich Schritt für Schritt den Schatten auf meinem Weg verwandeln. Nicht durch Kampf, sondern durch Bewusstheit.
Ob man an solche Dinge glaubt oder nicht – für mich war diese Erkenntnis heilsam. Sie gab mir ein tieferes Verständnis für das, was einst unerklärlich schien.
Ich verstand, dass manche Wege sich nicht einfach schließen, weil wir versagen, sondern weil etwas – innerlich oder äußerlich – unseren Fluss blockiert.
Und doch: sobald das Bewusstsein erwacht, beginnen sich diese Wege wieder zu öffnen. Genau so geschah es bei mir.
Als ich begann, die Zusammenhänge zu sehen und mein eigenes Licht nicht mehr in Frage zu stellen, lösten sich Knoten, die mich jahrelang gehalten hatten.
Ich durfte erkennen, dass kein Schatten ewig ist – und dass selbst das, was uns aufhält, Teil unseres Erwachens sein kann.
Nach den Prüfungen entschied ich mich, wenigstens mein Fachabitur zu erlangen. Ich wollte mir selbst beweisen, dass all die Jahre des Lernens, des Kämpfens und Durchhaltens nicht umsonst gewesen waren.
So begann ich ein einjähriges Praktikum bei der gesetzlichen Krankenkasse – und konnte mein Fachabitur schließlich in Kombination mit meinen Zeugnissen vom Gymnasium bestätigen lassen.
Es war kein großer Triumph im äußeren Sinn, aber für mich war es ein stiller Sieg.
Ein Schritt, der mir zeigte, dass auch nach all den Rückschlägen etwas in mir immer weiterging. Dass mein Weg – so verworren er manchmal auch war – nie wirklich stehen geblieben ist.
Ich hatte gelernt, dass Erfolg viele Gesichter hat.
Manchmal zeigt er sich nicht in Noten oder Abschlüssen, sondern in der inneren Kraft, trotz allem weiterzugehen.
Fünf Jahre meines Lebens – für ein Fachabitur.
Fünf Jahre voller Prüfungen, Umwege, Erfahrungen und innerem Ringen. Fünf Jahre, in denen ich so oft scheiterte und doch jedes Mal wieder aufstand.
Zu diesem Zeitpunkt wurde mir auch klar, dass ich nicht alles studieren konnte, was ich mir einst erträumt hatte.
Ich akzeptierte es – nicht mit Resignation, sondern mit dem Gefühl, dass das Leben mich auf einen anderen Weg führen wollte. So entschied ich mich endgültig für eine Ausbildung.
In dieser Zeit lebte ich bereits mit meinem damaligen Freund in Braunschweig. Es war wieder eine ganz neue Phase meines Lebens – ruhiger, erwachsener, und doch voller innerer Fragen.
Nach all den Jahren des Kämpfens, des Suchens und des Scheiterns begann sich in mir langsam ein neues Bewusstsein zu formen.
Ich spürte, dass das Leben mich lehrte, Schritt für Schritt zu verstehen, dass nicht jeder Weg, den man sich vornimmt, wirklich der eigene ist.
Manchmal müssen Träume sich verändern, damit wir wachsen können.
Rückblickend würde ich diese Jahre als sehr prägend für meine Zukunft beschreiben. All das, was damals geschah – all die Prüfungen, das Scheitern, die inneren Kämpfe – sollte mich nicht brechen, sondern formen.
Ich sehe heute, dass genau diese Erfahrungen mich dorthin geführt haben, wo ich heute stehe.
Nein, ich bin nicht mit den besten Ergebnissen aus dieser Zeit hervorgegangen – zumindest nicht in dem Sinn, wie die Gesellschaft Erfolg misst.Nach 7 Jahren in Deutschland habe ich viel Wichtigeres bewahrt: mich selbst.
Damals habe ich nicht lange recherchiert, ob ich vielleicht doch mit Fachabitur Architektur studieren könnte. Heute frage ich mich manchmal, warum ich mir nicht mehr Mühe gegeben habe, das wirklich herauszufinden, denn es war möglich..Vielleicht lag es an all den Umständen, die damals über mir zusammenkamen – an der Erschöpfung, an den vielen Entscheidungen, die gleichzeitig getroffen werden mussten.
Und doch spüre ich: es war alles richtig so. Ich entschied mich, in dieser Richtung zu bleiben – und begann eine Ausbildung als technische Zeichnerin im Bereich Heizung, Klima und Sanitär.
Es war kein glamouröser Weg, kein großer Traum aus Kindertagen. Aber er war real. Greifbar. Und vielleicht war genau das, was ich damals brauchte – etwas, das mich erdete, nachdem so vieles zuvor unsicher und brüchig gewesen war.
Inmitten all des Nebels aus Lebensumständen, Konflikten und Unsicherheiten bin ich meiner inneren Stimme treu geblieben. Ich habe mich selbst nicht verloren. Und vielleicht war genau das der wahre Erfolg.
Denn so, wie das Leben mich immer wieder prüfte, hat es mich auch gelehrt, weiterzugehen – Schritt für Schritt, mit offenem Herzen. Immer vorwärts. No matter what.
Und so begann ich, diesen neuen Abschnitt anzunehmen – nicht als Ende, sondern als Beginn von etwas anderem.
Als ich nach der Schulzeit mit meinem damaligen Freund zusammenzog, begann ein neuer Abschnitt in meinem Leben.
Plötzlich wurde alles heller, ruhiger, sicherer.
Die kommenden fünfeinhalb Jahre fühlten sich an wie ein Aufatmen – als würde mein Inneres zum ersten Mal wirklich zur Ruhe kommen.
Ich möchte nicht zu tief in diese Zeit eintauchen, weil mein ehemaliger Partner heute verheiratet ist und ich die Vergangenheit mit Respekt in Frieden lassen möchte.
Aber eines darf gesagt werden: Er war der Erste, der mich wirklich als Partnerin sah.
Er behandelte mich mit Respekt – aufrichtig, klar und mit einer stillen Tiefe, die mich bis heute berührt.
Durch ihn habe ich gelernt, was es heißt, gesehen, geschätzt und angenommen zu werden. Ich durfte einfach sein. Mit all meinen Farben, mit Licht und Schatten.
Er nahm jede Seite von mir an – ohne Urteil, ohne Forderung. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar.
Doch die wichtigste Erkenntnis kam erst später, in einem anderen Lebenskapitel. Diese Beziehung war die Grundlage für etwas, das ich bis heute in mir trage:
Ich habe nie einem Mann erlaubt, mich schlecht zu behandeln – weil ich wusste, dass es auch anders geht.
Ich kannte das Gefühl, mit Respekt, Wärme und Aufrichtigkeit geliebt zu werden.
Vielleicht auch, weil meine erste ernste Beziehung zu einer Art Maßstab wurde – eine unsichtbare Bar, an der alles, was danach kam, gemessen wurde.
Nicht nur von anderen, sondern auch von mir selbst.
Und damit meine ich nicht, dass ich spätere Partner miteinander verglich. Es ging vielmehr darum, dass ich durch diese erste Beziehung gelernt hatte, wo meine persönlichen Grenzen liegen – welchen Standard, welches Maß an gegenseitigem Respekt, Tiefe und Präsenz ich in einer Beziehung brauche.
Diese innere Messlatte blieb – nicht aus Stolz, sondern aus Bewusstsein.
Ich wusste, was sich richtig anfühlt. Und ich konnte nicht mehr zurück in etwas, das darunter lag.
Er gab mir das, was mir meine Eltern nie gegeben haben – was mir mein Vater nicht auf den Weg mitgegeben hat. Und genau deshalb konnte ich es nicht übersehen, wenn etwas weniger als das war.
Ich habe gelernt, Grenzen zu setzen – liebevoll, aber klar. Ich weiß, was Respekt bedeutet, und ich erwarte ihn ohne Zögern. Kein Mann durfte mich je herabsetzen, verletzen oder entwürdigen.
Ich war meist verliebt – oder glaubte es zumindest. Erst viele Jahre später habe ich verstanden, dass ich in Wahrheit nur zwei Männer in meinem Leben wirklich geliebt habe – ehrlich, tief und seelisch.
Damals sah ich in meinem Partner einen sicheren Ort, einen ruhigen Hafen.
Ich hatte zuvor einige enttäuschende Erfahrungen gemacht – nichts Dramatisches, aber schmerzhaft genug, um die Sehnsucht nach Beständigkeit zu wecken.
Und wenn man meinen Lebensweg bis dahin kennt, versteht man, warum ich mir etwas Stabiles wünschte.
Damals war es eine bewusste Entscheidung, dass er der Richtige sei – doch unbewusst spürte ich mit der Zeit, dass es nicht wirklich das Richtige für mich war.
Mein Freund zögerte nicht. Mit ruhiger, fester Stimme mischte er sich ein – und brachte meinen Vater sofort zum Schweigen. Er blieb respektvoll, aber in seiner Bestimmtheit lag genug Kraft, dass mein Vater verstummte. Es war die schönste und stärkste Geste, die ich je von jemandem erfahren habe.
Darum empfand ich seine Zuneigung als etwas Kostbares, Erfrischendes – etwas, das mich atmen ließ. Ich ging damals in diese Beziehung mit der Hoffnung, dass Vernunft und Stabilität genügen könnten. Doch das, was meine Seele suchte, war mehr.
Vielleicht war es für eine Zeit richtig, ganz sicher heilend – aber nicht für ein ganzes Leben.
Es ist bekannt, dass viele Frauen in ihren Beziehungen scheitern, weil sie die Liebe ihres Vaters nie wirklich erfahren haben. Und obwohl mich dieses Thema später im Leben immer wieder einholte –obwohl ich nach dieser schönsten Erfahrung nie zuließ, schlecht behandelt zu werden – zog ich dennoch Männer an, die mich nicht wirklich liebten.
Und so blieb Schmerz später im Leben nicht aus. Nicht, weil mich jemand gezielt verletzt hat, sondern weil ich oft früh spürte, wenn etwas nicht stimmte – wenn Worte und Absichten nicht im Einklang waren. Ich erkannte Muster, noch bevor sie sich wiederholten.
Und so endeten viele Verbindungen, ehe sie wirklich begannen.
Denn tief in meiner Seele kannte ich keine Liebe. Nicht die, die nährt. Nicht die, die bleibt.
Und so prägte sich ein Muster, das mich später dazu führte, noch tiefer an mir zu arbeiten. So viel Schattenarbeit, so viele Erkenntnisse – all das musste erst durch mich hindurchfließen, sich ordnen und filtern, bevor ich wirklich verstehen konnte, warum manche Dinge in meinem Leben einen bestimmten Weg genommen haben.
Zu vieles war von Anfang an schiefgelaufen – von meiner Geburt an.
Und ich durfte es, Stück für Stück, heilen. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Doch in dieser Beziehung spürte ich deutlich, dass mich das alltägliche Leben – so, wie es viele kennen – krank machte. Arbeit, ein Zuhause, Kochen, ein geregelter Alltag – all das ließ meine Seele langsam austrocknen. Sie hungerte nach etwas anderem.
Ich war diejenige, die nach den Seiten blickte – ob in der Diskothek oder bei der Arbeit. Ich suchte ständig nach Ablenkung, Aufmerksamkeit und nach einem Funken Leben. Ich genoss die Aufmerksamkeit, ohne etwas Bestimmtes zu wollen – es ging nur um ein Gefühl, um ein kleines Stück Adrenalin, um das Neue.
Dieser Hunger nach Neuem führte mich immer wieder in extreme Situationen. Als würde das Leben mich dorthin schicken, wo Wachstum unvermeidlich war.
Mich faszinierten Gespräche mit Menschen, die sich mit innerer Entwicklung beschäftigten – mit Themen, die über das Bekannte hinausgingen. Heute weiß ich, dass das kein Zufall war: meine Seele trägt die Schwingung der Fünf – Freiheit, Veränderung, Tiefe und Erfahrung. Ich war nie für ein starres Leben bestimmt. Ich musste fühlen, erleben, mich bewegen, um zu verstehen.
Ich liebte mit meinen Ohren. Ich liebte es, wenn ich etwas lernen durfte – wenn ein Gespräch mich innerlich weiterbrachte, wenn ein Gedanke etwas in mir berührte.
Und so ist es auch in Beziehungen: Bis heute spüre ich keinen Funken, wenn ein Mann mir nichts beibringen kann – wenn ich fühle, dass ich ihm in seiner Entwicklung voraus bin.
Damit meine ich nicht alte Vorstellungen von Rollen oder Macht, und auch nicht das Bild eines Mannes, der „das Sagen“ hat. Es geht nicht um Überlegenheit, sondern um Resonanz – um seelische Reife und Bewusstsein.
Ich spreche von Entwicklung. Von einem Mann, der führt, ohne zu dominieren. Der Halt gibt, weil er selbst tief verwurzelt ist. Der seine Frau nicht klein hält, sondern sie mit sich wachsen lässt.
Heute, wo sich für so viele Männer alles nur noch um materielle Güter dreht, verliere ich schnell das Interesse. Ein Paradox – denn ich liebe die materielle Welt. Ich habe immer von einem gehobenen Lebensstandard geträumt.
Doch was mich wirklich fasziniert, ist die gesunde Balance zwischen der spirituellen und der materiellen Welt. Diese Verbindung reizt meine Sinne, sie weckt mein Interesse und inspiriert mich.
Ein Mann, der nach der Arbeit einfach nur auf dem Sofa liegt, ein Mann, der keine Ziele verfolgt, die ihn wachsen lassen – er hat keinen Platz in meinem Leben.
Diese Einsicht hat sich über die Jahre entwickelt und immer weiter verfeinert. Heute, mit all diesen Vorstellungen, meiner Lebenserfahrung und den Standards, die ich für mich selbst geschliffen habe, bleibt für solche Männer kein Raum mehr. Ich akzeptiere kein leeres Gerede, verschwende meine Zeit nicht mit oberflächlichen Bekanntschaften.
Ich bin zu riskant. Ich bin zu unberechenbar. Ich bin zu frei.
Zu bewusst, um mich manipulieren zu lassen – und genau das schreckt auch viele Männer unbewusst ab.
Aber wieder einmal ein Sprung zurück – in die früheren Tage, noch zu Hause. Ich musste mir damals meinen Computer selbst kaufen – in Ratenzahlung –, weil weder meine Oma noch mein Vater bereit waren, mich zu unterstützen.
Ich wollte ihn ausschließlich für die Schule haben, denn schon auf der Realschule wusste ich, dass ich ohne Computer auf dem Gymnasium kaum zurechtkommen würde.
Und im Rückblick zeigte sich: Ich hatte Recht.
Was das allerdings bei der Verwandtschaft auslöst, kannst du dir sicher vorstellen.
Meine Oma unterstützte mich immer finanziell – so gut sie konnte. Doch genau das wurde später oft zum Auslöser für Streit, sobald Geld im Spiel war.
Alle meine kleinen Scheiterungen – besonders die finanziellen – wurden von ihnen im Gedächtnis abgespeichert. Wie eine unsichtbare Liste, die sich über die Jahre füllte.
Und als ich später im Leben eine meiner schwächsten Phasen durchlief, wurde genau das gegen mich verwendet. Jede Erinnerung, jede Ratenzahlung, jede Entscheidung – plötzlich stand alles wieder im Raum. Nicht als Mitgefühl, sondern als Beweis.
Ein Beweis für das, was sie mir schon immer andichten wollten: dass ich nicht gut genug bin, dass ich niemand ohne sie bin, dass meine Art zu leben ein Fehler ist, dass ich ein Problem habe.
Doch das war nie die Wahrheit – es war nur ihr Spiegel, nicht meiner.
Sie haben meine Vergangenheit gesammelt, um sie mir in Momenten der Schwäche vorzuhalten. Doch das verletzte mich nicht mehr – zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, wie solche Menschen funktionieren. Ich verstand, warum sie mich angriffen, und ich habe längst gelernt, meine eigenen Schwächen anzunehmen, zu akzeptieren und zu transformieren.
Sie hingegen wussten das nicht, weil sie es selber nicht konnten, weil sie nie bereit waren, sich mit ihrem eigenen Schatten auseinanderzusetzen. Schattenarbeit war für sie ein Fremdwort – innere Heilung, ein Gebiet, das sie mieden.
Sie blieben lieber in der Rolle derjenigen, die urteilten, anstatt in den Spiegel zu schauen. Ich aber habe diesen Weg gewählt – den unbequemen, ehrlichen Weg zu mir selbst.
Und genau das unterscheidet uns.
Doch zurück zur „Computersache“… Wie so oft mischten sich Verwandte ein.
Sie redeten meiner Oma ein, dass ich keinen Computer brauche. Schließlich, sagten sie, hätten ihre Kinder keinen Computer auf der Hauptschule gebraucht.
Ein Computer sei nur Luxus – nichts für die Schule. Selbst wenn es Luxus gewesen wäre – War das eine stille Andeutung darauf, dass ich es nicht wert war?
Diese Ratschläge, die aus ganz anderen Lebensvorstellungen und Erfahrungen kamen, hielten mich zurück und erschwerten vieles. Meine Oma hörte – wie so oft – eher auf andere Stimmen als auf meine eigene.
Dadurch lernte ich früh, dass man nicht immer Verständnis oder Unterstützung erwarten kann – selbst nicht von den engsten Familienangehörigen.
Mit der Zeit fiel mir auf, dass es oft gerade diejenigen sind, die am wenigsten Erfahrung oder Wissen haben, die am lautesten ihre Meinung äußern.
Und was das Etikett der Moral betrifft – auch das kann nicht jeder tragen.
Moral hat nichts mit Worten oder Ansprüchen zu tun, sondern mit Bewusstsein, Mitgefühl und Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber.
Menschen neigen dazu, ihre eigenen Begrenzungen und Ängste auf dich zu projizieren – Besonders dann, wenn du es wagst, aus der Reihe zu tanzen.
Sie selbst haben sich vieles nie erlaubt – also verstehen sie nicht, wie du es kannst.
„Du bist doch niemand“, sagen sie vielleicht. „Wir haben dich doch aus dem Dreck gezogen.’ "Wenn wir es uns nicht trauen – wie kannst du es wagen?"“
Doch genau hier liegt die Einladung an dich: Erkenne, dass das, was dir über dich gesagt wird, selten wirklich etwas über dich aussagt.
Es sind Projektionen – Spiegel fremder Grenzen, nicht deiner. Sie zeigen nicht, wer du bist, sondern wer die Menschen sind, die dich umgeben.
Weil ich vieles immer sofort haben wollte, rutschte ich in Ratenzahlungen.
Doch meine Ratenzahlungen waren nie für Vergnügungen, Alkohol oder Dinge ohne Sinn.
Sie waren immer Investitionen in meine Weiterbildung, in mein Wachstum, in meinen Weg nach vorn.
Diese Zeit hat mich viel über Eigenverantwortung gelehrt – aber auch darüber, wie schwer es ist, wenn man seinen Weg ganz allein erkämpfen muss.
Bis heute sehe ich, wie die lautesten Menschen noch immer in denselben Vorstellungen und Mustern gefangen sind wie damals – auch nach zwanzig Jahren – weil sie nie etwas anderes gelernt haben. Und da ich grundsätzlich keine Ratschläge erteile, sage ich hier nur eines: Ich wünsche mir, dass jeder Mensch ehrlich und offen in sich hineinschaut. Dann würde ihm weder die Zeit noch die Kraft bleiben, bei anderen nach Fehlern zu suchen.
Der Grund, warum ich diese ganze „Computersache“ hier erwähne, ist, dass sie in meinem Leben eine viel größere Rolle gespielt hat, als man vielleicht denkt.
Dadurch, dass ich mir erst relativ spät – mit 18 Jahren – einen Computer leisten konnte, weil ich erst dann eine Ratenzahlung beginnen durfte, hatte das Folgen, die weit über das Materielle hinausgingen.
Meine Fähigkeiten im Umgang mit dem Computer waren dadurch lange Zeit nicht besonders ausgeprägt. Selbst als ich später auf dem Gymnasium war, fehlte mir das, was viele Kinder in Deutschland schon seit ihrer Kindheit selbstverständlich gelernt hatten.
Dieses Grundwissen fehlte mir später auch während meiner Ausbildung zur technischen Zeichnerin – einem Beruf, in dem man eigentlich schon mit einer gewissen Erfahrung starten sollte.
Das zeigte sich auch in meinem Selbstbewusstsein. Ich wurde von einer älteren Auszubildenden oft belächelt, wenn ich einfache Begriffe oder Programme nicht kannte.
Und die Person, die mich anlernen sollte, nutzte meine Unsicherheit – die man mir damals deutlich anmerkte – manchmal für abwertende oder verletzende Bemerkungen.
Ich fühlte mich gemobbt, ausgelacht, missverstanden. Die genauen Worte weiß ich heute nicht mehr, aber das Gefühl – dieses schmerzliche, brennende Gefühl der Demütigung – bleibt.
Nach etwa einem Monat meiner Ausbildung hatte ich auf dem Heimweg eine Panikattacke am Steuer. Ich weinte – aus Schmerz, aus Ohnmacht, aus Überforderung. Am Straßenrand der Autobahn hielt ich an, um mich zu beruhigen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort stand – aber irgendwann konnte ich weiterfahren.
Vielleicht war genau dieser Moment der Grund, warum ich die Ausbildung trotzdem zu Ende brachte – weil ich dort zum ersten Mal innehalten und atmen musste, statt einfach nur zu funktionieren.
Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich damals nichts gesagt habe – warum ich niemandem in der Firma erzählte, was wirklich passiert war.
Die Wahrheit ist: Ich hatte Angst. Angst, dass man mir nicht glaubt. Angst, dass es mir als Schwäche ausgelegt wird. Angst, dass ich meine Ausbildung verliere – dass man denjenigen glaubt, der schon lange im Unternehmen war, und nicht der neuen, unsicheren Auszubildenden.
Tief in mir lebte noch das alte Trauma aus meiner Schulzeit – die Erfahrung, das Abitur nicht bestanden zu haben. Diese Wunde nagte an meinem Selbstwert, zog mich innerlich nach unten. Heute erscheint mir das alles so fern – fast wie ein anderes Leben. Doch damals hatte ich nicht die Lebenserfahrung, nicht die innere Stärke und das Vertrauen, das ich heute habe.
Mein Leben war stark von äußeren Einflüssen geprägt – und mein Inneres noch zu verletzlich, um sich zu schützen.
Und wenn du dich jemals in einer ähnlichen Situation befindest, möchte ich dir eines sagen:
Rede. Schweigen schützt nicht – es macht nur einsamer.
Kein Mensch hat das Recht, dich klein zu machen oder zu verletzen. Hol dir Hilfe, sprich mit jemandem, dem du vertraust. Du musst solche Erfahrungen nicht allein tragen.
Und vor allem: Lass niemals zu, dass jemand deine Unsicherheit gegen dich verwendet.
Lerne, mit deinen Schwächen zu arbeiten – liebevoll, geduldig, ehrlich. Denn wenn du deine Schatten kennst, kann sie niemand mehr gegen dich richten. Dann verliert jeder Angriff seine Kraft, und das Licht fällt zurück auf den, der ihn aussendet.
Deine Sensibilität ist kein Schwachpunkt – sie ist Ausdruck deiner Tiefe, deines Fühlens, deiner Seele. Halte dich selbst, wenn niemand sonst es tut. Denn in diesen Momenten beginnt eine wahre Heilung.
Damals begann ich auch zu verstehen, wie das Berufsleben wirklich funktioniert: Man wird beobachtet. Und sobald man Unsicherheit zeigt, wird sie von manchen als Angriffspunkt genutzt – besonders von denen, die sich durch deine Energie getriggert fühlen. Das führt dazu, dass viele Menschen ihre wahren Gefühle überspielen, eine Maske tragen, um bloß nicht verletzbar zu wirken.Sie bauen enormen Druck in sich auf – zu viel Stress, zu viele Erwartungen an sich selbst, nur um ja nicht zu scheitern.
Doch dieses ständige Verbergen und Hineinfressen zerstört das innere System. So entstehen Depressionen, Krankheiten, Erschöpfung, Burnouts – und schließlich zerstörte Persönlichkeiten.
In unserer Gesellschaft gelten gerade jene, die offen zu ihren Gefühlen und Schwächen stehen, oft als schwach. Dabei sind sie in Wahrheit die Stärksten. Denn sie öffnen in sich einen Prozess der echten, reinen Liebe – zu sich selbst und zum Leben.
Ja, damals gab es viele Lücken in meinem Bewusstsein, viele Unsicherheiten.
Und diese waren offen sichtbar für andere. Manche griffen das an – vielleicht, weil sie trotz allem etwas in mir spürten, das sie selbst nicht hatten: mein Licht, mein Streben nach Wachstum, mein inneres Verlangen nach etwas Besserem.
Trotz all meiner Schwächen ging ich weiter. Und ich hörte nicht auf.
Das Leben entwickelte sich weiter, und nach fünf Jahren kam in mir der Drang auf, aus meiner Beziehung auszubrechen – der Beziehung, die von außen als perfekt galt.
Viele sahen sie als etwas, das man sich nur wünschen kann. Doch innerlich fühlte ich mich, als würde ich langsam ersticken.
Ich konnte damals nicht verstehen, was mit mir geschah. Schließlich hatte ich doch alles, was man in diesem Alter „haben sollte“: eine stabile Partnerschaft, Sicherheit, Pläne für eine mögliche Hochzeit, Kinder, ein gemeinsames Haus.
Aber nichts davon berührte mich wirklich. Ich wollte das alles nicht. Es war nicht das, was ich wirklich wollte – es war nur die Erwartung, so zu leben, wie alle lebten.
Manchmal weinte ich ohne jeden erkennbaren Grund. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen damaligen Partner war das ein Rätsel. Heute weiß ich, dass es meine Seele war, die sich meldete. Sie wollte frei sein.
Ich konnte damals nicht verstehen, was mit mir geschah. Schließlich hatte ich doch alles, was man in diesem Alter haben sollte. Und doch – tief in mir war etwas leer. Etwas, das ich nicht benennen konnte.
Ich fragte mich immer wieder: Was stimmt nicht mit mir? Warum bin ich unglücklich, obwohl alles so perfekt scheint?
Es war, als würde meine Seele weinen – still, kaum hörbar, aber unaufhörlich.
Ich hatte das Gefühl, nicht mein eigenes Leben zu leben. Als würde ich jemanden betrügen – und dieser jemand war ich selbst.
Ich lebte das Leben anderer. Ich erfüllte Erwartungen, die nie wirklich meine waren. Vielleicht blieb ich auch, weil ich nicht undankbar wirken wollte, nicht egoistisch.
Ich wollte das Gute sehen, nicht verletzen, nicht enttäuschen.
Doch dabei verletzte ich mich selbst – weil ich mir nicht eingestand, dass ich mich längst belog. Ich wollte die perfekte Freundin sein, die alles richtig macht, die den Vorstellungen anderer entspricht. Aber in diesem Drang, nach außen „richtig“ zu sein, habe ich mich innerlich verloren. Ich spürte mich nicht mehr – nicht meine Bedürfnisse, nicht meine Wahrheit.
Es kommt nicht oft im Leben vor, dass man einem so wundervollen Menschen begegnet. Er gab mir alles, was ich wollte – zumindest das, was ich damals in Worte fassen konnte. Doch so vieles blieb ungesagt, unentdeckt, unbemerkt – auch für mich selbst.
Und genau deshalb weinte meine Seele. Nicht, weil ich ihn nicht liebte, sondern weil ich mich selbst nicht mehr hören konnte. Ich wollte hinaus in die Welt. Ich wollte meine hungrige Seele beruhigen, etwas Neues erleben – etwas, das meine Seele heilen würde.
Damals wusste ich jedoch nicht, dass es überhaupt etwas zu heilen gab. Ein Appell an dieser Stelle:
Das Schlimmste, was man tun kann, ist, sich selbst zu belügen – nur um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das ist der direkteste Weg in die innere Zerstörung.
Ich habe später erkannt, wie tief diese Wahrheit geht. Denn wie willst du jemandem vertrauen, der sich selbst belügt? Wer sich selbst nicht ehrlich begegnet, kann auch einem anderen keine echte Nähe schenken.
Das wurde für mich zu einem Maßstab – in Freundschaften, in Beziehungen, in jeder Form von Verbindung. Ich achte bis heute darauf, dass Menschen um mich herum zuerst mit sich selbst ehrlich sind. Nur dann kann Vertrauen wachsen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein – sondern echt.
Und genau das zählt für mich. Deine Vergangenheit spielt keine Rolle, solange du daraus etwas gelernt hast. Denn wahrer Wert entsteht nicht aus Fehlerlosigkeit, sondern aus Bewusstsein – aus dem Mut, sich selbst wahrhaftig zu sehen.
Mein Leben hatte sich mittlerweile so entwickelt, dass ich vor allem nach dem Materiellen strebte. Ich war mit den Jahren eine starke Frau geworden und glaubte, meine Vergangenheit längst hinter mir gelassen zu haben.
Ich dachte nicht, dass meine Kindheitstraumata noch immer Einfluss auf mein Leben haben. Ich war stolz auf das, was ich erreicht hatte – auf meine Stärke, auf meinen Weg.
Doch erst viel später verstand ich, dass man sich seinen Kindheits Wunden stellen muss, wenn man wirklich frei und ganz werden will.
Ich war so unerfahren, so stark geprägt von familiären und gesellschaftlichen Erwartungen. Doch etwas in mir wollte mehr.
Und so entschied ich mich, für ein Jahr ins Ausland zu gehen – gemeinsam mit meiner damaligen besten Freundin. Ein Feuer der Aufregung brannte in mir. Ich hatte ein Ziel, einen Traum – und alles fühlte sich plötzlich möglich an.
Ich entschied mich für ein Jahr in Kanada. Es gab viele Gründe, warum gerade Kanada – sagen wir so: Es war einfacher, dorthin zu gehen als in die USA.
Nach meiner Ausbildung wollte ich Modedesign studieren. Mode spielte schon immer eine Rolle in meinem Leben, und ich plante alles so, dass ich nach meiner Rückkehr mit dem Studium beginnen könnte.
Zuerst musste ich jedoch meine Ausbildung abschließen. Da sie insgesamt dreieinhalb Jahre dauerte, ich aber nicht länger warten wollte, entschied ich mich, sie um sechs Monate zu verkürzen.
Das war nur mit guten Noten möglich – und die hatte ich. Mit den Jahren hatten sich meine schulischen Leistungen stark verbessert.
Gerade hier wurde mir bewusst, wie sehr äußere Stabilität und inneres Gleichgewicht mit Erfolg und Leistung verwoben sind.
Und trotzdem trug ich im Hinterkopf noch diesen Gedanken: „Es ist ja nur eine Ausbildung – ein Studium ist etwas für die wirklich Schlauen.“
Wie tief und falsch dieser Gedanke war! Ich hatte mir eingeredet, dass mein früheres Scheitern etwas mit meiner Intelligenz zu tun hatte – dass jemand, der „nur“ eine Ausbildung macht, nicht klug genug ist.
Aber das war ein Irrtum, wie ich heute weiß. Ich hatte mich selbst in diese enge Ecke gedrängt – mit meinen eigenen Gedanken.Deshalb möchte ich dir etwas mitgeben: Unterschätze niemals deine eigene Kraft. Deine Gedanken formen deine Wirklichkeit.
Ich reichte also meinen Antrag ein, um meine Ausbildung zu verkürzen – und er wurde genehmigt. Damit inspirierte ich drei weitere Mitschülerinnen, das Gleiche zu tun.
Wir bildeten eine kleine Lerngruppe, trafen uns abends mehrmals in der Woche, um all das zu üben, was uns in der Berufsschule noch nicht vermittelt wurde.
Es war eine spannende Zeit – wir hatten uns ein Ziel gesetzt, das nicht viele wählten, und wir erreichten es. Ich bestand meine Ausbildung mit einer guten Note und öffnete mir damit meinen Weg in die Freiheit.
Nach der Ausbildung kümmerte ich mich um meine Bewerbungsmappe für das Modedesign Studium in Hamburg. Ich nahm an einem Vorbereitungskurs teil, in dem man innerhalb von zwei bis drei Monaten seine Studienmappe zusammengestellt hat.
Ich liebte diese Zeit – ich liebte die Kunst, das Schaffen, die Freiheit des Ausdrucks.
Unter der Woche lebte ich bei einer Bekannten, die ich nur über Umwege kennengelernt hatte. Eine gemeinsame Freundin brachte uns zusammen, und ich zog für drei Monate bei ihr in Hamburg ein.
Wir teilten eine kleine Wohnung, ein Bett, viele Abende voller Gespräche und Lachen.
Aus dieser Begegnung wurde eine tiefe Freundschaft, die bis heute besteht – und für die ich sehr dankbar bin.
In dieser Zeit wurde meine Beziehung zu meinem damaligen Freund jedoch immer schwieriger.Wir stritten oft, trennten uns ein paar Mal – und kamen doch jedes Mal wieder zusammen.
Ich erinnere mich an einen Moment während eines dieser Streits: Ich weinte so sehr, dass ich eine Panikattacke bekam und keine Luft kriegte... Vielleicht war genau das auch der Grund, warum wir damals zusammen blieben. Ob es Mitgefühl von seiner Seite war, weiß ich bis heute nicht.
Rückblickend kann ich nur sagen: Wenn ich ihn damals noch wirklich geliebt hätte – mit dem Wunsch, ihn nicht zu verlieren – wäre ich niemals allein nach Kanada gegangen.
Ich hätte alles getan, um an seiner Seite zu bleiben. Denn wenn ich es liebe, dann mit ganzem Herzen – mit jeder Faser meines Seins.
Damals verstand ich das aber noch nicht. Doch im Rückblick sehe ich: Wegzugehen war mein Ausweg aus dieser Beziehung. Wäre ich geblieben, hätte ich es nie geschafft, ihn zu verlassen – zu sehr war ich emotional gebunden..
Es war eine andere Liebe – die zarte Zuneigung zu einem Menschen, der wie ein Bruder war, wie ein vertrauter Freund, dem man einfach nur Gutes wünscht.
Eine Liebe, still und rein – wie zu einer vertrauten Seele, zu einem Menschen, der gütig war, dem man nur Licht wünscht.
Während dieser Jahre hatte ich auch einen starken Schutz an meiner Seite – eine besondere Beziehung zu seiner Familie. Seine Eltern gaben mir etwas, das meine eigenen mir nie schenken konnten: Wärme, Zugehörigkeit, echte Liebe.
Bis heute besteht der Kontakt, besonders zu seiner Mutter. Und das schätze ich sehr.
Noch immer verbindet uns ein tolles, warmes Gefühl füreinander – etwas, das viele nicht verstehen konnten und das manche vielleicht sogar neidisch machten.
Mein Vater hingegen sieht das bis heute als etwas Falsches. Er meinte, es sei nicht richtig, mit den Eltern des Ex-Partners befreundet zu bleiben. Doch ich weiß: Es ist einfach sein begrenztes Verständnis – und auch andere in meiner Familie dachten ähnlich.
Ich erkannte, dass es manchmal keinen Sinn macht, mit Menschen zu diskutieren, die aus einem anderen Bewusstsein heraus leben. Manche Menschen verstehen Herzensverbindungen nicht, weil sie sich selbst nie erlaubt haben, sich so tief zu fühlen.
Aber es geht nicht darum, sie zu verurteilen. Es geht darum, zu sehen – wirklich zu sehen – und zu verstehen, dass jeder nur aus dem handelt, was ihm im Inneren möglich ist.
Jeder Mensch begegnet dir nur auf der Wellenlänge, auf der er selbst gerade ist.
"You meet others only as deeply as you have met yourself."
Du begegnest anderen nur so tief, wie du dir selbst begegnet bist.
Und genau darin liegt so viel Wahrheit. Denn jede Begegnung spiegelt den Raum, den wir in uns selbst geöffnet haben – nicht mehr und nicht weniger.
Damals wusste ich nicht, ob mein Wunsch, ins Ausland zu gehen, meine Beziehung zerstören würde. Aber tief in mir spürte ich, dass ich auf meine innere Stimme hören musste – ohne genau zu begreifen, warum oder wozu sie einen rief.
Vielleicht erscheint sie unlogisch, vielleicht halten andere sie für verrückt oder verwirrend.
Doch sie ist dein Kompass. Deine Wahrheit. Die einzige Stimme, die dich niemals verraten wird. Ich habe diese Stimme gehört – auch wenn nichts Sinn ergab, auch wenn Angst und Unsicherheit mich begleiteten.
Heute weiß ich: Genau das war der Anfang meines Weges zurück zu mir selbst.
Und so kam es zu diesem Punkt, dass ich am Flughafen in Berlin stand – mit nur einem Koffer meiner Sachen, 1000 Euro in der Tasche, die für ein ganzes Jahr reichen sollten, und meiner besten Freundin an der Hand.
Mein damaliger Freund hat uns hingefahren; damals waren wir noch zusammen, und sein Abschied fiel mir schwer.
In diesem Moment wurde mir schlagartig bewusst, was es bedeutet, in ein anderes Land zu gehen – ohne ihn, ohne jegliche Stabilität oder Unterstützung. Meine Entscheidungen wurden von vielen Menschen als naiv und riskant angesehen, einfach weil sie sich selbst nie gewagt hätten. Doch mein Wunsch war es schon immer, ein Leben zu führen, das ich niemals bereuen würde.
Und so war es – und so ist es bis heute.
Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als das eigene Leben nach den Standards anderer zu leben, eigene Wünsche zu begraben aus Angst und später – irgendwann im Leben – am Sterbebett zu merken, wie sehr man bereut, etwas nicht getan zu haben. So ist es bis jetzt geblieben: ich habe niemals bereut, was ich getan habe, und ich habe mich nie für meine Fehler oder unbewussten Verletzungen geschämt.
Ich bereue nur eine einzige Sache: etwas, das ich nicht getan habe.
Und es lebt immer noch in mir... obwohl ich mit meinem ganzen Leben zufrieden bin, stellt sich mir bis heute diese eine Frage:
Was wäre, wenn ich es doch getan hätte?
Vielleicht schreibe ich irgendwann auch darüber.
Es geht eher in den privaten Bereich, es geht um eine andere Person, um meine erste Liebe.
Aber zurück zu meiner Abreise.
Mir kamen Tränen. Wir umarmten uns.
Wir versprachen einander, uns nach einem Jahr wiederzusehen. Und doch, tief in meinem Herzen, wusste ich, dass es ein Abschied für immer war. Ich habe das nie geplant. Wie du weißt, handelte ich in solchen Momenten immer aus meinem Gefühl heraus – aus dem, was meine Seele wollte. Mein menschlicher Verstand hatte damals noch nicht genug Lebenserfahrung, um zu verstehen, warum.
Ich ging ins Ungewisse, voller Erwartung, dass ich ein unglaublich interessantes Jahr erleben würde: neue Menschen, neue Sitten, eine neue Sprache, ein neues Land. Das Ungewöhnliche wartete auf mich hinter dem Ozean – und genauso war es.
Angekommen, lebten wir einen Monat lang bei fremden Menschen, umsonst.
Es hieß damals CouchSurfing. Unter Reisenden war das sehr beliebt – eine Plattform, auf der Menschen aus aller Welt die Möglichkeit hatten, ein paar Nächte in einem Haus zu verbringen, ohne dafür zu bezahlen. Dafür gab man eine Bewertung ab, und diejenigen, die diese Möglichkeit anboten, hatten meist schon ein gewisses Rating und nutzten den Service selbst.
Wahrscheinlich stehen dir jetzt die Haare zu Berge, weil du denkst, wie gefährlich das war – und irgendwo hast du recht.
Doch mit Angst zu leben und nichts auszuprobieren, kam für mich nie in Frage. Meine größte Angst war immer etwas anderes: public speaking. Das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, dachte ich damals...
So war es möglich, im ersten Monat schon sehr viel Geld zu sparen, während ich und meine beste Freundin nach einem Job suchten. Diese CouchSurfing-Angebote kamen meistens von Männern, weil Männer in solchen Dingen oft mutiger sind. Und natürlich – wir zwei junge, hübsche Mädchen hatten immer Glück mit dem Stay.
Aus manchen dieser Bekanntschaften wurden für einige Zeit sogar Freundschaften, nicht tief und nicht für immer, aber für den Moment genug. So war es mit CouchSurfing: ein Austausch von Kulturen, Meinungen, kleinen Lebenswelten. Manche Begegnungen waren nur flüchtig, andere ein wenig tiefer, und doch blieb alles leicht.
Würde ich das heute noch einmal machen? Wahrscheinlich nicht...
Nicht aus Angst – sondern wegen der Lebensstandards und Erwartungen, die ich inzwischen an mich selbst habe. Heute wäre es für mich nicht mehr stimmig. Doch damals, mit 25 Jahren, war es vollkommen in Ordnung. Die Welt war offen, ich war neugierig, mutig und bereit, alles auszuprobieren. Es war eine andere Zeit in mir – eine Zeit der Leichtigkeit, des Entdeckens und des Vertrauens ins Leben und Menschen..
Und diese Erfahrung war immer positiv..
Ob in Kanada oder in Amerika – wir nutzten CouchSurfing damals noch einmal auf unserer Reise entlang der Westküste. Auf diese Weise zahlten wir nichts für Unterkunft. Wir lernten neue Menschen kennen, die uns auch ihre Städte zeigten, uns herumführten, ihre Lieblingsplätze mit uns teilten.
Um in Kanada bleiben zu können und sich alles leisten zu können, brauchten wir Geld. Also begaben wir uns auf Jobsuche. Meine Freundin war vorher schon ein Jahr in Australien gewesen, sie hatte dort Englisch verbessert und dadurch fiel es ihr viel leichter, einen Job zu finden. Ihr erster Job war in einem Café, wo sie Kaffee und Kuchen an der Theke verkaufte.
Ich erinnere mich noch an den Moment, als sie mir am Strand erzählte, dass sie bereits anfangen würde zu arbeiten. Ich weiß noch, dass ich tief schlucken musste, weil ich keine Englischkenntnisse hatte und ich wusste, dass ich mich mit einem weniger guten Job zufriedengeben musste... und dass es lange dauern würde, bis mich überhaupt jemand nehmen würde.
Aber ich war positiv eingestellt. Ich machte mich auf den Weg mit dem einzigen Satz, den ich auswendig gelernt hatte: „I’m looking for a job.“
Ich ging in verschiedene Hotels, um mir einen Housekeeping-Job zu ergattern. Einige sagten, sie würden sich melden. Ich weiß nicht, wie viele Absagen es waren. Gab es Zweifel, ob es eine falsche Entscheidung war?
Nein. Ich wusste: man muss immer zuerst den ersten Schritt machen, bevor der zweite kommt. Und dass das Universum einen immer begleitet – man muss nur gehen.
Und so war es auch.
Ein Pizzaladen gab mir nach zwei Monaten in Kanada einen Job. Ich sollte Pizzastücke verkaufen, auf einer Hauptstraße in Vancouver – Granville Street, eine Straße, die tagsüber und nachts sehr aktiv war. Alle Nightclubs waren dort, Junkies bewegten sich wie in einem Traum über die Straße, dazwischen bescheidene kleine Läden. Ich konnte schon ein paar Sätze sagen, kommunizieren, erklären, wie viel etwas kostet – und so fing es an.
Dieser Job war so intensiv. Ich wurde oft abends eingeteilt, die Pizzeria war bis vier Uhr morgens offen. Die Disco-Leute kamen, um etwas zu essen. In Deutschland würde man sich vermutlich einen Döner holen – das gab es dort auch, aber nicht so schmackhaft wie bei uns. Die Pizza war sehr beliebt in der Nacht. Sie kamen betrunken, high und manchmal aggressiv.
Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich eine Obdachlose aus dem Laden bitten musste. Es war auch mein Job, dafür zu sorgen, dass die Kunden sich wohlfühlen und nicht bedrängt wurden. Manchmal bedeutete das auch, dass ich jemanden bitten musste zu gehen. Ich tat genau das – mit meinem gebrochenen Englisch. Ich bat sie, hinauszugehen. Sie wurde sehr laut und beschimpfte mich. Und dann stand sie sehr lange draußen und guckte mich durch das Fenster an...
So riskierte ich jede Nacht, dass ich von irgendwelchen Junkies angegriffen werden konnte. Ich musste mir auch Sorgen machen, nicht von Obdachlosenangegriffen zu werden – die Granville Street war voller verzweifelter, verlorener Menschen, besonders nachts, wenn ich allein unterwegs war.
Um fünf Uhr morgens, nachdem alles geputzt war und die Pizzeria geschlossen wurde, musste ich allein in der Dunkelheit nach Hause gehen.
Gut, dass wir in der Innenstadt ein Zimmer gemietet hatten, meine Freundin und ich. Das war auch, um die Kosten zu sparen. Bis heute ist es in Kanada sehr üblich, „roommates“ zu haben. Das Leben dort ist so teuer, dass es sich viele nicht leisten können, eine Wohnung für sich alleine zu haben. So leben sehr viele mit anderen Menschen zusammen – besonders Studenten aus der ganzen Welt, Reisende, vor allem in der Innenstadt.
So riskierte ich jede Nacht, dass ich von irgendwelchen Junkies angegriffen werden konnte. Und doch hat es sich mit den Jahren so vertieft, dass ichkeine Angst mehr vor ihnen hatte.
Schlimmer war die Zeit an sich. Die Abendschichten stressten mich.
Zu Hause hatte ich dann Albträume – ich lief im Schlaf herum oder sprach im Traum. Oder ich griff im Schlaf nach der Stehlampe, weil ich dachte, sie nehme die Pizzastücke von den Blechen – als wäre sie ein Kunde. Das tat ich alles halb wach, im Halbschlaf, irgendwo zwischen Traum und Realität. Meine Freundin musste mich dann wachrütteln. Ich träumte von dem ganzen Stress in diesem Job, wo es irgendwie wie auf einer Laufbahn weitergehen musste, damit sich die Schlange vor der Theke verkleinerte.
Meine Stärke war immer meine Schnelligkeit. Ich war sehr schnell und konnte mit dem Stress in der Situation gut umgehen. Das war eine Eigenschaft, die ich im Ausland sehr schnell lernen musste –und ich lernte, sie auszunutzen. Jeder Arbeitgeber, der mich jemals eingestellt hatte, schätzte mich wahrscheinlich genau dafür. Ich ersetzte zwei, manchmal sogar drei Arbeitskräfte. Und das öffnete mir sehr oft Türen.
Was ich aber auch lernen musste, war, dass meine emotionale Gesundheit darunter litt. Damals kannte ich mich damit nicht aus. Ich hatte inzwischen gelernt, stark zu sein. Weißt du noch, wann dieser Punkt war?
Und so lebte ich mein Leben. Ich konnte es nicht ertragen, wenn jemand schwach war. Wenn jemand eine Heulsuse war oder keinen Finger rührte.
Wenn für jemanden bestimmte Dinge einfach „zu viel“ waren. Ich redete mir ein, dass ich alles schaffen konnte. Ich dachte, ich hätte keine Wahl.
Dann gab mir noch ein Hotelbesitzer einen Job als Housekeeping. Und so arbeitete ich zwei Jobs gleichzeitig – bis ich das Hotel schließlich kündigte. Ich verkaufte lieber Pizza als Zimmer sauberzumachen – und das war aus vielen Gründen richtig.
Erstens hatte ich viel mehr Kontakt mit Menschen und konnte meine Sprachkenntnisse verbessern. Ja, auf einem minimalen Level, aber ich war ständig im Austausch. Ich hörte andere sprechen, antwortete, wiederholte, lernte jedes Mal ein kleines bisschen dazu. Im Hotel dagegen war ich nur mit mir selbst beschäftigt, allein zwischen Betten, Handtüchern und Staubsaugern. Keine Gespräche, keine Begegnungen, nichts, was michsprachlich weitergebracht hätte.
Zweitens: jedes Mal, wenn ich im Hotel ein Zimmer fertig machte, musste ichdaran denken, dass ich in Deutschland einen gut ausgeübten Beruf hatte. Dass ich in einer schönen Wohnung lebte. Und jetzt stand ich hier und machte diese Jobs, weil ich die Sprache nicht ausreichend sprach.
Diese Scham, dieses Gefühl, eine Stufe herunterzugehen, gab mir auch dasGefühl, rückwärts zu gehen. Es war nie ein Plan meines Lebens.
Darum musste ich so schnell wie möglich da raus – nicht, weil dieser Job „etwas Schlechtes“ war, sondern weil man physisch so fertig ist, dass man keine Zeit und keine Kraft hat, etwas zu tun, das einem bessere Lebensverhältnisse bieten würde.
Und ja, ich wusste, es war nur für ein Jahr.
Aber ich war gegangen, um etwas Besseres zu erleben.
Der Pizzaladen war laut, chaotisch, voller Energie, manchmal hart – aber er war lebendig. Und genau das brauchte ich damals.
Mit jedem Monat wurde mir bewusster, wie es um meine Sprachkenntnisse stand. Und heute kann ich sagen: sie waren so minimal, dass ich mich bis heute frage, wie ich das alles geschafft habe.
Manchmal wurde ich nach irgendetwas gefragt, was nicht um Pizza ging, und ich lächelte wie eine Stumme, weil ich nichts verstand – und trotzdem wollte ich nicht unhöflich sein. Und so lernte ich jeden Tag einen neuen Satz oder einneues Wort dazu.
Zum Neujahr sollte ich in der Pizzeria an Silvester arbeiten. Und da entschied ich für mich, dass es Zeit war zu gehen. Ich war nicht ins Ausland gegangen, um an Feiertagen zu arbeiten – besonders nicht in einem Job, der mich nicht glücklich machte. Ich suchte mir schnell einen anderen Job in einer Pizza-Bar,die schon ein bisschen gehobener war, und durfte am Neujahr feiern.
Aber mit den besseren Arbeitsverhältnissen mussten sich auch meine Sprachkenntnisse verbessern. Ich wurde Kellnerin – und dafür braucht es schon mehr, als immer nur die gleichen Pizzastücke zu verkaufen.
Die Sprache musste fließen, ich musste mich ausdrücken können, Gespräche führen, Bestellungen aufnehmen, reagieren, lachen, zuhören.
Meine Sprachkenntnisse mussten besser werden – also passte ich mich an. Ich beobachtete, ich lernte, ich wurde besser. Ich hatte kein Englisch in der Schule, wenn du dich erinnerst. Meine Englischkenntnisse kamen aus dem Leben in Kanada: durch Kommunizieren, durch Lesen auf Englisch und durch sehr, sehr viele Fehler. Und all das musste ich machen, damit die Scham weggeht – die Scham, anders zu sein.
Ich war wieder in einem anderen Land, ohne die Sprache zu beherrschen. Und es lag an mir: mich zu verstecken, weil es mir peinlich war, nicht perfektzu sein... oder mich unter die Menschen zu mischen und zu lernen. Ich wählte das Zweite – und ich war sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Doch die Scham wegen der Sprache war nicht das Einzige. Es gab viele Momente, in denen ich dachte:
Du hattest doch ein schönes Leben – wozu das alles?
Jedes Mal, wenn diese Frage kam, wusste ich sofort, dass es mein Verstand war – vom Ego besessen, nicht meine Seele. Meine Seele wusste, dass ich irgendwo auch herunterkommen musste. Dass ich ein wenig Demut lernen musste.
Meine Erfahrungen in Kanada haben nicht nur mich als Mensch verändert. Sie haben mir gezeigt, wie viel ich alleine schaffen kann.
Das war erst der Anfang der Hürden, die ich überwinden musste. Ich wechselte meine Jobs ein paar Mal in Kanada. Ich möchte sie nicht alleerwähnen, aber es ging immer weiter und vorwärts. Ich war immer noch im Service, aber die Locations wurden gehobener und besser. Damit wuchs auchmeine Sicherheit im Land, und meine Englischkenntnisse verbesserten sich.
In diesem Jahr musste ich sehr viel über mich selbst lernen. Vor allem über die Tatsache, dass mich Menschen im Ausland anders annahmen. Ich bekam mehr Komplimente für mein Aussehen, meinen Charakter oder meine Qualitäten, als jemals zuvor in Deutschland. Und das war etwas, das ich lernen musste – anzunehmen.
Die Menschen in Kanada waren sehr offen und positiv eingestellt, sie nörgelten nicht so viel herum. Obwohl es vielen wahrscheinlich schlechter ging als in Deutschland. Und das war etwas, das ich immer sofort fühlen konnte. Ich war unter Menschen, die dem Leben positiv gegenüberstanden.
Vielleicht lag es daran, dass es ein multikulturelles Land war.
Mittlerweile – von 10 Kanadiern ist vielleicht 3 wirklich in Kanada geboren. Es ist dicht besiedelt mit Ausländern. Und ja, es gibt immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen war es so natürlich dort, einen Akzent zu haben, eine andere Sprache zu sprechen. Man war nicht „anders“. Es war ein Teil der kanadischen Kultur – so habe ich es empfunden.
Doch neben der neuen Sprache lernte ich auch meine beste Freundin neu kennen. Ich fing an zu verstehen, dass sie mich anders zu sehen begann – vielleicht, weil ich auf eine bestimmte Art und Weise bei den Leuten ankam.
Diese Seite kannte sie bisher nicht von mir. Mit den Jahren verstand ich, dassich immer in ihrem Schatten stand. Unsere Freundschaft wurde als Duo gesehen, doch sie war die Dominante.
Und ja, ich erinnere mich sehr oft daran, wie ich einfach mitgezogen habe, damit ich „die Gute“ war. Denn so zu sein, wie ich wirklich war, mit meinenSchattenseiten und meiner eigenen Meinung, wenn mir ihr Verhalten nicht gefiel – das konnte ich davor nicht. Die Angst, sie als Freundin zu verlieren, war zu groß. Und so wurden viele Entscheidungen in unserer Freundschaftvon ihr beeinflusst.
Ich traute mir selbst nicht. Ich betrog mich selbst, ohne es zu wissen. Ich hatte nicht genug Wertschätzung für mich selbst, um zu verstehen, dass ich nicht weniger wert war als sie. Dass sie in keinem Punkt „besser“ war als ich. Sie war nur erfolgreicher in der Schule, in ihren Sprachkenntnissen und in ihrem Status, weil sie aus einer besseren Familie stammte und von ihren Eltern geliebt und verwöhnt wurde...
Und genau das ist die Situation, in der ich mich betrog: weil mein Abbringungstrauma etwas in mir hinterließ, das ich nie verstand – aber das trotzdem mein Leben so stark beeinflusste.
Da kommt auch der innere Glaube an sich selbst ins Spiel – zumindest an der Oberfläche. Später musste ich oft feststellen, dass selbst das nicht immer ausreicht, um sich wirklich tief zu lieben. Ich kannte Menschen, die es in der Kindheit viel besser hatten und trotzdem nicht an sich glaubten. Aber zumindest in der Jugend haben sich solche Menschen sehr oft wohl gefühlt in ihrer eigenen Haut.
Und es war auch die Zeit, in der es mich so sehr störte, dass man uns nicht trennte. Dass sogar meine Entscheidungen hinterfragt wurden mit dem Satz: „Und was hält deine Freundin davon?“
Als müsste ich meine Entscheidungen über mein Leben durch sie laufen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Identität verwechselt wurde. Dass die Dinge, die sie machte, automatisch auch mir zugeschrieben wurden.
Wenn sie sich auf eine bestimmte Weise verhielt, wurde angenommen, ich würde genauso handeln. Und das gefiel mir nicht.
Sehr schnell stellte ich fest, dass ich außerhalb der gewohnten Umgebung in Deutschland endlich anfing, mich selbst zu sehen. Ich wollte mein eigenes Licht scheinen lassen – nicht von einem anderen Menschen gedimmt werden.
Ich wollte nicht, dass meine Eigenschaften ihr zugeschrieben wurden oder andersherum.
Ich begann, Seiten an mir zu entdecken, die ich vorher nie gesehen hatte.
Und so wuchs in mir eine unbewusste Abneigung ihr gegenüber. Heute weiß ich genau, was es war: An ihrer Seite konnte ich nicht sein, wer ich war.
Nicht, weil sie es verboten hätte – sondern weil ich noch nicht selbstbewusst genug war, mich selbst zu zeigen. Aber ich war schlau genug zu verstehen, dass ich es nicht schaffen würde, solange sie da war. Denn sie würde mich immer daran erinnern, wer ich früher war. Und sie liebte mich auch genauso: bequem, unsicher, leicht manipulierbar, ein nettes Mädchen, ein graues Mäuschen irgendwie.
Ja – vielleicht war ich optisch kein graues Mäuschen mehr.
Aber innerlich war ich so tief verletzt, dass ich weder erklären noch sehen konnte, wie tief mein eigenes Ich vergraben war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie das irgendwann liest, sie sagen würde, dass sie es nie so gesehen hat. Dass sie mich in Wahrheit für bestimmte Eigenschaften auch bewundert hat – denn irgendwann waren es auch ihre Worte.
Aber ich bin mir sicher, sie würde sich auch eingestehen können, dass es mit mir leicht war. Weil ich zu allem Ja sagte. Weil ich in unserer Freundschaft ein Mitläufer war. Ich war bequem.
Es gab ein paar Momente in unserer Freundschaft, in denen ich Nein sagte oder mich weigerte. In solchen Situationen nannte sie mich „schwierig“ oder war verärgert, weil man sich angeblich nicht auf mich verlassen konnte.
Was sie damit meinte: Es gefiel ihr nicht, wenn ich für mich einstehen wollte.
Es gefiel ihr nicht, wenn ich mich selbst wählte.
Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen ich oft hörte, ich sei „dumm“, „crazy“, „schwierig“ oder „nicht empathisch genug“.
Diese Beurteilungenkamen immer dann, wenn ich mich von narzisstischen Menschen löste –wenn ich die Verbindung komplett abschnitt und niemandem mehr erlaubte, seine Programme und Ängste auf mich zu projizieren.
Jedes Mal, wenn jemand ein Problem damit hatte, dass ich mich selbstwählte, konnte ich sehr klar erkennen, wer davon profitiert hatte, dass ich die „Gute“ war. Und ich sage es bewusst, denn damals verstand ich es nicht anders. Ich hatte meine Schattenseiten noch nicht angenommen.
Der Weg begann damit, Nein zu sagen. Meine eigene Meinung zu halten.
Getrennte Wege zu gehen.
Es war lang, es war schmerzhaft – und mit derZeit wurde es leichter. Heute handhabe ich es bewusst. Wenn ein Mensch mir lange wichtig war, warne ich vorher, bevor ich vollständig gehe. Nicht aus Drama, sondern aus Respekt. Doch tief in mir weiß ich: Wer an meiner Seite sein will, wird sich mitentwickeln. Nicht für mich – sondern für sich selbst.
Ich weiß, wie schwer es ist, sich zu verändern. Ich tue es seit vielen Jahren.
Und ich habe gelernt: Es macht keinen Sinn, sich für jemand anderen zuverändern. Darum erwarte ich es auch nicht von anderen.
Und somit bleiben nur zwei klare Wege: Ich akzeptiere den Menschen vollständig, wie er ist, wenn ich ihn in meinem Leben behalten möchte oder ich gehe, wenn das Verhalten meine Energie herunter zieht, mich kleinmacht, mich an mir zweifeln lässt.
Ich habe keine Bereitschaft mehr, mich emotional klein zu machen, damitjemand anderes sich besser fühlt.
Dafür gibt es Therapeuten. Sie werden dafür bezahlt.
Meine einzige Einladung ist: Wenn du mitkommen willst, wohin ich gehe, erwarte ich, dass du schon an deinem inneren Weg arbeitest.
Wenn jemand aber an der alten Version von mir festhält, oder an der alten Version von sich selbst, ohne etwas zu verändern, dann trennen sich unsere Wege. Und ich wünsche aus vollem Herzen alles Liebe – nur ohne mich.
Und ich handle heute so, weil ich genau weiß, wie viele Jahre, wie viel Zeitund wie viele emotionale Achterbahnfahrten ein solcher Weg bedeutet. Selbst wenn man ihn mit dem Wunsch beginnt, es zu schaffen – es ist ein Prozess.
Man kann nicht von einem Menschen erwarten, dass er innerhalb von einer Woche dort ankommt, wo du bereits seit Jahren gehst. Und genau diese Tatsache ist wichtig: Erfahrung sammelt sich über Zeit, durch unzählige Entscheidungen, Schritte, Fehler, Erkenntnisse und Neubeginne.
Und deshalb ist es für mich so wichtig zu verstehen: Wenn ich einen Menschen sehe, der nicht denselben Weg gehen will oder kann, dann können wir nicht zusammen weitergehen.
Nicht, weil ich nicht helfen möchte – im Gegenteil, ich bin bereit zu helfen.
Aber es darf nicht so weit kommen, dass seine Energie mich herunterzieht. Ich kann nicht mein Leben, meine Richtung, meine Gesundheit opfern, nurdamit ein anderer sich besser fühlt.
Hilfe ja – aber nicht auf Kosten meines eigenen Weges.
Denn meine emotionale Gesundheit ist heilig. Sie ist mein Fundament.
Und sie ist heute das Wichtigste, das ich habe.
Damals verstand ich das noch nicht. Ich konnte es nicht in Worte fassen –diese Erkenntnisse brauchten Jahre. Ich spürte nur eines: Ich muss diesen Weg allein gehen. Damit ich ankommenkann. Über diesen Abschnitt meines Lebens erzähle ich im nächsten Kapitel. In Kanada lernte ich noch jemanden kennen, der mein ganzes Lebenverändert hat. Es hat zwischen uns nicht funktioniert... überrascht? Mich damals schon. Weil ich ihn nicht besonders toll fand und glaubte, ich sei zugut für ihn. Wie naiv...
Etwas, das ich damals an meiner eigenen Haut erst lernen musste: Das Äußere eines Menschen bestimmt nicht seinen Wert.
Und weil ich in meiner letzten Beziehung gelernt hatte, mich selbst zu respektieren und diesen Respekt auch zu erwarten, konnte ich in neuen Begegnungen bestimmte Dinge zuerst nicht sehen – bevor überhaupt etwas daraus wurde.
Ich bemerkte Muster oft erst in der Beziehung, nicht davor. Ich erwartete ein bestimmtes Verhalten, doch ich wählte die falschen Männer aus. Ich suchte nach Selbstbewusstsein – und merkte nicht, wie gut manche Männer es vorspielen konnten. Und erst, als ich schon mitten drin war, erkannte ich, dass vieles nur eine Fassade war.
Dann kamen die echten Fragen, die dazu führten, dass die Beziehungenscheiterten. Ich wusste sehr genau, was ich in einer Partnerschaft erwarten wollte –aber ich hatte keine Erfahrung damit, einen solchen Partner überhauptanzuziehen.
Denn ich hatte selbst noch viele offene Baustellen.
Und immer noch viel zu heilen in mir.
Doch dieser Mensch bewirkte etwas in mir, das tiefer ging, als es jede Beziehung zuvor gab: ich begann eine Reise in mich selbst.
Zum ersten Mal fing ich bewusst an, an meinen Schwächen zu arbeiten. Ich nahm ein Blatt Papier, wahrscheinlich eine Methode, die ich aus einem Buch kannte, und schrieb alle negativen und positiven Eigenschaften von mir auf.
Ich wusste bereits, woran ich schwach war – und ich begann zu überlegen,wie ich es besser machen kann. Was notwendig ist. Welche Schritte.
Dieser Mensch hat mein Herz so tief gebrochen, dass ich nach Fehlern in mir suchte. Wie es so typisch ist bei Menschen, die nicht an sich glauben.
Die denken in erster Linie: Was ist falsch mit mir?
Und doch war nichts falsch mit mir. Ich war einfach nicht die Richtige für ihn.
Aber ich begann, an mir zu arbeiten. Und das tue ich bis heute.
Nach jeder Trennung kehrte ich zurück zu mir. Ich setzte mich zusammen, um zu verstehen, warum ich doch so gut bin – und warum es nie klappt. Und jedes Mal gab es etwas, das ich verbessern konnte.
Und das war sehr wichtig: nicht in eine andere Beziehung zu rennen, um den Schmerz zu betäuben, sondern sich mit den eigenen Wunden auseinanderzusetzen und tief zu graben.
Mit der Zeit musste ich nicht mehr zu mir zurückkehren, um Fehler zu suchen.
Jede Trennung wurde leichter für mich – emotional, als Mensch. Ich suchte keine Fehler mehr in mir, weil ich viele davon bereits geheilt hatte.
Ich litt, weil mir dieser Mensch fehlte.
Dieser Mensch hinterließ etwas Wichtiges in meinem Leben.
Er zeigte mir durch seine Anwesenheit, was es bedeutet, ein erfülltes Lebenzu fühlen – ein Leben, in dem man sich ständig weiterentwickelt.Und nein, er war nicht die große Liebe, die ich schon mal erwähnt habe. Es tat weh, weil er mir die Welt zu meinen Schwächen öffnete. Auf eine Art, die sich wie Liebe anfühlte – aber es war die Enttäuschung darüber, sich so sehr geirrt zu haben. Zu glauben, man sei „zu gut“ für jemanden, und dann zu erkennen, wie viele Wunden in einem selbst noch offen sind.
Wunden, an denen gearbeitet werden muss, bevor eine emotional erwachsene Beziehung funktionieren kann.
Es war der Anfang einer Reise, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie brauche.
Ich musste lernen zu verstehen, warum ich immer wieder emotional nicht-verfügbare Menschen anzog. Warum es immer so schnell scheiterte. Es begann wie im Märchen und hörte genauso plötzlich auf. Immer.
Ich bin am 23.02. geboren. Und die Energie der 2 lernt ihre Lektionen durch Beziehungen. So war es immer bei mir – früher unbewusst, heute weiß ich es.
Ja, mein Herz wurde gebrochen. In kleine Stücke. Sehr oft.
Aber ich habe gelernt: das Zerbrochene kann geheilt werden. Stück für Stück.
Und auch wenn es danach nicht mehr das unberührte, glatte Herz ist... es wird zu etwas Besonderem. Etwas viel Stärkerem.
In Japan gibt es eine Kunst und eine Philosophie dafür: Kintsugi.
Zerbrochene Keramik wird dort nicht versucht, unsichtbar zu kleben – sie wird mit Gold repariert. Die Risse werden hervorgehoben, nicht versteckt.
Die Botschaft dahinter berührt mich tief: was zerbricht, kann schöner und wertvoller werden als zuvor.
Die Brüche sind Teil der Geschichte.Sie machen es einzigartig.
Und genauso erlebte ich es mit meinem Herzen. Mein Herz war nicht weniger wert, weil es Risse hatte. Es wurde kostbarer, weil es sie hatte. Mit jeder Heilung, mit jedem Schritt, mit jeder Erkenntnis floss „Gold“ hinein.
Und genau darin fand ich meine innere Stärke: nicht in der Unversehrtheit, sondern in der Fähigkeit, immer wieder zu heilen.
Man entwickelt die Fähigkeit, sich selbst zu lieben – so wie man ist.
Mit allen Wunden, allen Rissen, allen Schrammen.
Und ich sammelte neue Schrammen in Kanada...
Ich musste sehr vielarbeiten. Sehr oft war meine Freundin unterwegs – ohne mich. Sie konnte ess ich finanziell besser leisten.
Sie hatte keine Schulden, die sie abbezahlen musste.
Ich dagegen musste jeden Monat noch unseren Kredit für die Möbel in Deutschland abbezahlen. Es war nicht viel, aber es zeigte sich in allem, was ich machen konnte und wie viel ich mir leisten durfte.
Ich erinnere mich gut daran, wie körperlich erschöpft ich damals war. Ich war fix und fertig, weil ich immer sehr viel arbeitete. Das war ich schon aus Deutschland gewohnt: während meiner Ausbildung arbeitete ich an den Wochenenden in der Diskothek, und manchmal halfen wir den Eltern meines Freundes mit ihren Nebenjobs. Nicht viel – aber es gab immer mehrere Jobs gleichzeitig.So war mein Leben: Ich arbeitete mich müde. Ich arbeitete mich wund.
Weil ich dachte, dass es das Einzige wäre, was mich weiterbringen würde. Ich wusste nur, dass ich körperlich stark war. Aber auch, weil die Programme dergesamten Ahnenlinie in mir tief saßen.
Es gab niemanden in der Familie, der einen intellektuellen Beruf ausübte.
Soweit ich wusste, waren alle immer handwerklich tätig. Die Glaubenssätze wurden weitergegeben, von Generation zu Generation. Sie fließen im Blut.
Das Selbstbewusstsein zu haben, daran zu glauben, dass man es besser schaffen kann – reicht allein nicht aus.Die Blockaden müssen gelöst werden.
Und das kann Jahre dauern.
Und genau so war es auch in Kanada. Ich arbeitete – viel. Und ich dachte,das sei normal für mich.
In diesem Jahr sind wir aber trotzdem sehr viel gereist. Eine Reise durch Kalifornien.
Die Reise entlang der Westküste Kaliforniens war unvergesslich. Wir mieteten ein Auto, flogen zuerst nach Los Angeles, verbrachten dort ein paar Tage und fuhren dann los nach San Francisco. Es war eine der schönsten Strecken, die ich je gesehen habe.
Wir hielten immer wieder an, um die Aussichtspunkte zu besuchen – entlang des Ozeans, auf den Klippen, mit dem Wind im Gesicht. So viele schöne Orte auf dem Weg: Santa Barbara, San Diego, San Francisco...Diese zwei Wochen waren eine der schönsten Zeiten meines Lebens.
Wir hatten so viel Spaß. Es war frei, lebendig, leicht.
Meine Freundin sagte später, es sei die schönste Reise ihres Lebens gewesen. Und das Gleiche habe ich Jahre danach noch einmal gehört – von einer anderen Freundin, die mich später in Kanada besucht hatte. Auch sie sagte, es sei die schönste Reise ihres Lebens.
Beide Freundinnen sind heute nicht mehr in meinem Leben.
Ich habe mich irgendwann bewusst von beiden getrennt.
Und es war jedes Mal ein Schock für diese Menschen. Ich war nie einfach nur das, was man von mir sah.
Viele Menschen sehen in mir oft nur das Lächeln, den Mut, die Leichtigkeit wie ich Entscheidungen treffe. Man könnte denken, ich wäre leichtsinnig oder naiv.
Aber in Wahrheit bin ich sehr tiefgründig – vor allem, wenn es um Menschen in meinem Leben geht. Ich sehe viel mehr, als ich zeige. Ich spüre sehr genau, wann etwas nicht stimmt, wann Energien nicht mehr passen, wenn etwas nicht mehr wächst. Und wenn ich gehe, dann nicht aus Laune, sondernaus Klarheit.
Wir reisten auch durch das schöne Land-Kanada, ein Flug nach Toronto, und dort verbrachten wir noch weitere vier Monate, bevor es zurück nach Deutschland ging.Zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass die Uni in Hamburg mich nicht angenommen hatte, weil meine Mappe nicht als eine der besten qualifiziert wurde. Von ungefähr 600 Bewerbern wurden nur etwa 40 als Studenten im Modedesign angenommen.
Und wenn ich ehrlich bin: Was hatte ich erwartet von einem zweimonatigen Vorbereitungskurs, wenn ich mich davor nie wirklich damit beschäftigt hatte?
Wenn ich nie ernsthaft in diese Richtung gezeichnet hatte?
Deswegen blieb ich, anstatt sechs Monaten, ein ganzes Jahr in Kanada – weil mein Working-Holiday-Visum ein Jahr lang gültig war.
Und meine Freundin traf dieselbe Entscheidung. Sie wollte bei mir bleiben.
Sie sagte, sie wolle nicht wegziehen, solange ich noch dort war.
Vielleicht war das ein Zeichen von Liebe, die sie mir gegenüber empfand.
Aber tief in mir konnte ich auch einen anderen Gedanken nicht loslassen: dass sie nicht wollte, dass ich ohne sie etwas Besseres erlebe.
Dass sie nicht akzeptieren konnte, kein Teil davon zu sein.Merkst du, wie viele Fragen und Gedanken immer wieder in mir auftauchten – in einer Freundschaft, die sich eigentlich harmonisch anfühlen sollte?
Und es ist keine Schuldzuweisung.
Es ist nur ein Zeichen dafür, dass ich mich davon trennen musste – um zu verstehen, wie viel von dieser Freundschaft überhaupt wahr war. Nicht nur von ihrer Seite, sondern auch von meiner.
Denn manchmal erkennt man erst in der Distanz, wie viel war echte Nähe, echte Verbindung, und wie viel war nur Gewohnheit, Bequemlichkeit oder das Bedürfnis, jemandem zu gefallen. Trennung bringt Klarheit. Nicht, um jemanden schlecht zu machen, sondern um zu sehen:
Was davon war wirklich?
Doch zu diesem Zeitpunkt trennte ich mich nur von meinem Partner in Deutschland, nach drei Monaten in Kanada. Ich verstand, dass es kein Jahr halten würde. Es war die Zeit, sich zu trennen. Und so wurde auch dieses Kapitel meines Lebens beendet.
War es leicht? Nein. Aber wahrscheinlich ein wenig leichter für mich als für ihn. Ich war diejenige, die weg ging. Ich war diejenige, die die Beziehung beenden wollte. Ich war der Initiator.
Und doch musste ich mich auch mit dieser Trennung beschäftigen.
Auch mich hat sie berührt, verwirrt, verletzt und gefordert.
Einige Jahre später äußerte sich eine Cousine zu diesem Thema – wie immer, ohne dass jemand sie danach gefragt hätte. Sie musste es in ihren Augen einfach sagen. Sie empfand unsere Trennung als etwas Negatives, das ich getan hatte. „Du hattest ja Spaß im Ausland, und er ist hier allein geblieben...“
Hm. Ich war ALLEIN im AUSLAND. Okay, mit meiner Freundin... doch die ersten Risse zeigten sich. Er war dagegen hier, in der Umgebung, die er kannte, geliebt von seiner Familie.
Aber darum ging es nicht. Es ging darum, dass ich wieder von der Familieunter die Lupe genommen wurde. Meine Entscheidungen wurden ständig zum Gesprächsthema – auch wenn niemand nach deren Meinung fragte. Ich war immer wie ein Dorn im Auge. Bis heute.
Nach einem Jahr in Kanada mussten wir zurückgehen. Unser Visum lief ab.
Ende August 2012 kamen wir wieder nach Deutschland.
Die Welt hier sah nun ganz anders für mich aus.
So viel hatte sich in mir geöffnet, so viel hatte sich verändert. Ich sah die Menschen, die ich kannte, mit anderen Augen.
Ich sah die Menschen allgemein anders an. Alles schien mir fremd.
Ich wollte nicht mehr hierher gehören, weil ich mich hier limitiert fühlte.
Vielleicht geht es jedem so, der einmal im Ausland war.
Meine Freundin sagte damals sogar, sie hätte innerlich etwas verloren durch dieses Jahr im Ausland. Man findet keinen Anschluss mehr, weil man nicht mehr alles einfach annimmt. Man ist nicht mehr zufrieden mit dem „normalen“ Leben. Man ist diesem Platz entwachsen – und wenn man bleiben soll, muss sich etwas ändern.
Man möchte nie wieder dahin zurück, wie es einmal war. Und wie es weitergehen soll, weiß man auch nicht.
Also fand ich erstmal einen Job in Hamburg, in meinem Beruf als technische Zeichnerin. Es war meine erste offizielle Stelle nach meiner Ausbildung. Ich saß in einem schönen Büro im Stadtteil St. Georg, nah am Hauptbahnhof, mit meiner eigenen Schreibtischfläche und einer Blumenvase auf dem Tisch, die mein neuer Arbeitgeber mir geschenkt hatte...
Damals wollte ich immer in Hamburg leben. Ich blieb zweieinhalb Monate. Dann kündigte ich. Noch in der Probezeit.
Und ich ging wieder zurück nach Kanada.
Kanada fühlte sich nie grausam an. Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich nicht Dunkelheit – ich sehe Licht. Ich habe nur von den Seiten erzählt, die mich geprägt haben.
Doch die Stadt selbst... Vancouver... sie hat sofort mein Herz gewonnen.
Vancouver ist ein Ort, an dem Natur und Stadt sich berühren wie zwei alte Freunde.
Ozean, Berge, Wälder – alles in derselben Bewegung.Du atmest Salz und Regen. Du hörst Möwen und Autos gleichzeitig.
Du spürst Freiheit in deiner Haut.
Die Stadt ist offen, multikulturell, weit.
Man spricht viele Sprachen dort, und man fühlt sich verstanden.
Man ist nie „anders“, sondern einfach ein Teil des Ganzen.
Vancouver hat eine besondere Ruhe. Keine Schwere – nur Weichheit.
Selbst der Regen fühlt sich wie ein warmer Mantel an.
Er gehört dazu, wie Atmen. Er reinigt, er klärt, er lässt die Bäume glänzen.
Am Meer sitzt man still und schaut in die Weite. Und ich hatte sogar einen Ort, zu dem ich immer ging, wenn ich innerlich zerbrach.
Ich suchte Heilung am Wasser.
Und wenn Wasser sich bewegt, wird es ruhig an der Seele. Im Hintergrund die Berge – groß, schützend, stark.
Viele würden sagen:
Vancouver ist ein Ort, an dem man sich selbst begegnet.
Man kann in der gleichen Stunde am Strand sitzen, einen Kaffee in der Stadttrinken, und später auf einem Berg stehen.
Das Leben hat dort Raum.
In Vancouver lernt man langsamer zu gehen. Bewusster zu sehen. Tiefer zu atmen.
Es ist eine Stadt, in der man spürt:
Ich darf hier sein.
Genau so, wie ich bin.
Und vielleicht war es genau deshalb, dass Vancouver mein Herz berührt hat – leise, natürlich, ohne Anstrengung.
Zurück in Kanada fühlte es sich für mich seltsam an, da ich nicht nach Vancouver ging, sondern nach Toronto, der Stadt, in der ich meinen letzten Job hatte. Dort konnte ich wieder von vorne anfangen…aber ich blieb nicht lange – nur etwa sechs Monate –, weil ich einen Plan hatte: so bald wie möglich nach Australien zu gehen.
Meine damalige beste Freundin hatte ein Jahr zuvor dort mit ihrem Partner verbracht, bevor wir nach Kanada reisten, und so wusste ich von ihr, dass man auf den Farmen in Australien ziemlich gut verdienen kann, wenn man schnell und fleißig arbeitet. Und das konnte ich immer. Ich wusste, dass ich vor keiner Arbeit zurückschrecken würde. Schon früh lernte ich, meine außergewöhnliche Fähigkeit, stark zu sein, genau dort einzusetzen, wo es anderen an Ausdauer oder Durchhaltevermögen fehlte.
Nach anderthalb Jahren in Kanada konnte ich zwar Englisch, aber nicht gut genug, um einen Bürojob zu bekommen.Und zu diesem Zeitpunkt war mein Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt, dass ich einen gut bezahlten Job in der Stadt hätte annehmen können. Damit wären viele weitere Aspekte einhergegangen, in denen ich mich unwohl gefühlt hätte. Daher entschied ich mich zunächst für etwas, bei dem ich mir sicher war, dass ich gut darin sein kann. Daher sammelte ich Obst und Früchte, weil ich mir meiner Sache sicher war: Ich konnte arbeiten. Und das konnte ich nur, solange ich jung war. Ich verstand, dass ich, wenn ich älter wäre, solche Jobs nicht mehr machen wollte. Aber in diesem Moment konnte ich es besser als viele andere. Solange alle anderen Backpacker in Australien ihr Geld fürs Reisen verdienten, habe ich entschieden, mein zukünftiges Studium in Kanada zu finanzieren. Ich wollte Modedesign in Vancouver studieren – nicht unbedingt die Stadt, die man als Modestadt ansehen würde, da hier viele in Jogginghosen von Lululemon unterwegs sind, aber für mich stand fest, dass ich Deutschland für immer verlassen wollte. Ich wollte in Kanada leben.
Es gab zwei Optionen: entweder jemanden heiraten – wie es einige in Kanada tun, um bleiben zu können – oder studieren, um später die Arbeitsvisa zu bekommen und mir ein Leben aufzubauen. Heirat hat mich nie fasziniert; ich wollte niemals meine Freiheit dafür aufgeben, besonders wenn ich es auch selbst erarbeiten konnte. Also entschied ich mich, meinem Wunsch, Modedesign zu studieren, nachzugehen – und das an einer privaten Universität, was natürlich bedeutete, dass ich sehr viel Geld bezahlen müsste. Aber ich tat es. Ich kannte meine Stärken und hatte, was viele nicht besitzen: Durchhaltevermögen und den Willen, etwas zu erreichen, selbst wenn andere nicht einmal anfangen würden. Schließlich entschied ich mich, mich an der Blanche Macdonald Centre in Vancouver zu bewerben.
Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass ich in Deutschland so schnell nicht so viel sparen würde, weil man dort einen höheren Lebensstandard hat. In Australien als Backpacker musste man sich mit einem sehr einfachen Lebensstil arrangieren. Ich kaufte ein T-Shirt für fünf Dollar und war unglaublich glücklich darüber. In Deutschland hätte ich mich über so eine kleine Ausgabe kaum gefreut. Dort war diese gewisse Abgehobenheit in mir, die die materielle Welt betraf, einfach viel stärker.
Die Schule kostete mich 22.000 CAD. Die Schule hatte meine Kreditkartendaten, und einmal im Monat buchten sie eine bestimmte Summe ab. Das Geld, das ich durch harte Arbeit verdiente, wurde sofort abgebucht. So stellte ich sicher, dass ich die Studiengebühren bezahlte, bevor ich wieder in Kanada ankam. Auf diese Weise konnte ich mich selbst „austricksen“: Ich zahlte alles im Voraus und garantierte so, dass ich nach eineinhalb Jahren nach Kanada zum Studieren gehen konnte, und das Geld nicht ausgebe.. Mit 27 Jahren begann ich wieder ein Studium – aber der Weg dorthin war alles andere als leicht.
Zuerst reiste ich nach Australien und wurde von einem Paar getroffen, das ich schon aus Deutschland kannte. Es hatte einen großen Vorteil, jemanden zu kennen, der sich schon länger dort auskannte und die Gesetze sowie das Leben eines Backpackers verstand. Sie besaßen ein Auto, was viele Dinge erleichterte, insbesondere, wenn man von einer Farm zur nächsten unterwegs war – der übliche Weg, um eine Arbeitsstelle zu finden.
In Deutschland hatte ich bereits viele Absagen erhalten, sodass mich jegliche Ablehnung auf einer Farm in Australien nicht mehr enttäuschte. Anfangs ist Enttäuschung sehr stark, doch je länger man Absagen bekommt, desto leichter fällt es, mit einem „Nein“ umzugehen. Irgendwann wird es zur Normalität, und man lernt, einfach weiterzumachen. Ein Nein ist dann nicht mehr endgültig – im Laufe der Zeit kann es sogar zu einem Ja werden, wenn man lernt, damit umzugehen. Ein Nein bedeutet meistens „noch nicht“. Mit der Zeit wird es weniger persönlich genommen, und es macht das Leben deutlich leichter.
Meine Ankunft in Australien war unglaublich aufregend. Ich war fasziniert von der Natur und dem Leben auf einer Farm – von der Einfachheit und der Klarheit des Lebensstils, der damit einhergeht. Ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich zu den glücklichsten Menschen in Australien gehörte. Das Farmleben lag mir sehr, weil ich selbst in einem Dorf geboren wurde und nichts mich erschreckte – weder die Tiere, obwohl sie in Australien anders waren als in Kasachstan, noch der staubige Boden, die einfache Lebensweise oder die Menschen. Alles fiel mir sehr leicht, und schwere Arbeit machte mir keinerlei Angst. Ich konnte alles und fühlte mich dabei unglaublich sicher.
Ich war schnell in allen Jobs, und der häufigste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe – egal, wo ich arbeitete – war: „Irina, du bist so schnell.“ Egal, ob es ein Bürojob oder ein Farmjob war, ich erledigte meine Aufgaben effizient und zügig. Vielleicht liegt es an meinem numerologischen Stern: Ich habe die Zahl 7,die ich 5 mal habe, die für schnelle Energie steht, und diese Energie hat mir schon oft im Leben weitergeholfen. Ich bekam sogar den Spitznamen „Irina, die schnelle Deutsche“.
Diese Energie hat mir auch geholfen, die schwierigsten und härtesten Zeiten zu überstehen. Es gab Tage, an denen ich bis zu 16 Stunden gearbeitet habe. Ich verbrachte sieben bis acht Stunden frühmorgens draußen beim Pflücken der Weintrauben und ging danach direkt in den Shed zum Packen.
An solchen Tagen schmerzte mein Körper so sehr, dass ich nicht einschlafen konnte. Er bebte von innen. Mir war übel und ich konnte nichts essen. Man war so erschöpft, dass der Körper keine Ruhe fand. Und an genau diesen Tagen wusste ich: Ich hatte meinem Körper versprochen, das nie wieder so zu machen. Ich bat ihn nur, diese Phase noch auszuhalten.
Aufgeben kam für mich nie infrage. Ich war zu stolz, um alles hinzuschmeißen und nach Deutschland zurückzugehen – aus vielen Gründen. Ich wusste, wenn ich es nicht schaffen würde, würde ich mir selbst niemals verzeihen. Hätte ich es anders angehen können? Auf jeden Fall. Nicht so euphorisch. Nicht so kompromisslos.
Aber genau darauf war ich innerlich stolz. Auf diese Stärke. Weißt du noch, wann sie angefangen hat?
Ich erinnere mich sogar an eine Packingshed, in der ich nach einem sechsstündigen Grapes-Picking draußen weiter arbeitete und die Weintrauben einpackte. Wir arbeiteten beim Einpacken als Gruppe. Meine Aufgabe war es, die Weintrauben in Tüten zu verpacken, nachdem die anderen beiden Teammitglieder die gepflückten Trauben bearbeitet und schlechte Früchte entfernt hatten. Es war wie ein Karussell, auf dem sich die Früchte bewegten: Meine Aufgabe war es, die sauberen Trauben herauszupicken und in Boxen zu packen, die anschließend in die Supermärkte geliefert wurden.
Unsere Gruppe war die schnellste, nur eine andere Gruppe, die schon seit mehreren Jahren diesen Job machte, war ein wenig schneller. Meine Hände hatten bereits Blasen, weil ich so schnell gearbeitet hatte, und die Plastik-Tüten, in die ich die Früchte packte, verursachten zusätzliche Schnitte auf meinen Händen..Wir waren jedoch erst ca. zwei Monate dort, und das erzeugte Bewunderung – und wie so oft auch etwas Neid.
Als Backpacker aus Deutschland war ich anders als viele andere, die nur zum Spaß Geld verdienten. Ich arbeitete hart, um mein Ziel zu erreichen, und hatte einen klaren Plan, wozu ich das Geld nutzen wollte, anstatt es einfach nur auszugeben. Nicht dass es falsch war, ich hatte einfach ein anderes Ziel. Doch meine Ziele lehrten mich, zu gehen, wenn man ausgenutzt und wie ein Sklave behandelt wird. Ich hatte meinen Job über einen Kontraktor, der ebenfalls Geld an mir verdiente.
Eines Tages gab es ein Meeting. Der Chef des Sheds machte alle zur Schnecke und sagte, unsere Schnelligkeit führe dazu, dass die Weintrauben nicht im perfekten Zustand verpackt würden. Er schrie uns alle an, als wären wir Menschen, die auf diesen Job angewiesen seien und keine andere Wahl hätten.
Es arbeiteten viele Menschen aus ärmeren Ländern dort, die mit diesem Job ihre Familien in Nepal und Indien unterstützten. Sie waren auf diesen Job angewiesen, und er nutzte das aus. Doch er machte keinen Unterschied zwischen Menschen und Dingen. Man hatte den Eindruck, dass er auf uns alle herabsah.
Nach diesem Meeting ging ich zurück zu unserem Karussell. Die Wut kochte in mir hoch. Ich hatte genug. Was ich nie akzeptieren konnte und lernen musste, war, von solchen Menschen wegzugehen. Meine Boxen waren gut – sonst wäre er zu mir gekommen. Er nutzte diese Methode, um Menschen in Angst zu versetzen, damit sie nicht nachließen.
So eine Strategie war nie etwas, das ich angestrebt hatte, geschweige denn bereit war zu akzeptieren.
Ich stürmte aus dem Shed hinaus und sagte etwas in der Art, dass solche Arbeitsverhältnisse nichts für mich seien.
Beide Chefs sahen mich mit weit geöffneten Augen an. Mein Kontraktor sagte noch:
„Das war doch nicht auf dich bezogen….“Er hat gerade eine seiner besten Arbeiterinnen verloren.
Ja, es war nicht direkt auf mich bezogen. Aber über einen Kamm geschoren zu werden und sich so etwas gefallen zu lassen, hätte bedeutet, dieses Verhalten meiner Vorgesetzten zu akzeptieren. Also ging ich.
Und dieses Gefühl der Befreiung strömte durch meinen Körper. Ich lachte laut und stolz, weil es sich einfach so gut anfühlte, aus diesem Hamsterrad auszusteigen.
Ich hatte etwas, das viele nicht hatten: einen Plan B. Ich konnte jederzeit nach Deutschland zurückgehen. Und ich hatte mich selbst. Ich wusste, dass ich egal wo einen Job finden konnte. Genau das gibt mir bis heute die Sicherheit, zu gehen, wenn es schlimm wird.
Und so erfuhr ich später, dass eine Gruppe aus Taiwan, die neben uns gearbeitet hatte, mich heimlich getimt hatte, um herauszufinden, wie viele Minuten ich für eine volle Box brauchte. Ihr Ziel war es, mich später zu uebertefffen. Das Witzige daran war: Sie konkurrierten mit mir, ohne mir etwas davon zu sagen – nicht aus Feindseligkeit, sondern weil sie besser werden wollten und mich beobachteten. Sie spielten ein unfaires Spiel. Wenn du mit mir konkurrieren willst, lass es mich wissen – dann kann ich mich noch mehr anstrengen. Denn in Wirklichkeit konkurrierst du gar nicht mit mir.
Wenn man mich wirklich studieren möchte, muss ich enttäuschen: Ich übertreffe mich bis zum heutigen Tag selbst. Ich bin anders, und ich entwickle mich immer weiter, und genau das ist meine Stärke. Ich werde fast immer unterschätzt. Mit der Zeit habe ich gelernt, das für mich zu nutzen.
Wenn ich spuere, dass ich unterschätzt werde – und das passiert mir sehr oft, weil ich offen, freundlich und zugänglich bin und manche denken, sie könnten mich leicht um den Finger wickeln –, steige ich innerlich aus dem Kampf aus. Ich spiele keine Spiele. Und wenn ich spiele, dann nur in angekündigten Kämpfen, nicht dort, wo Dinge hinterlistig oder unausgesprochen geschehen.
Das Witzige ist: Die Lebenserfahrung hat mir Stück für Stück gezeigt, wie viele Menschen mich zunächst als Inspiration wahrnehmen und dann versuchen, mich zu übertreffen – sei es im familiären oder freundschaftlichen Kreis, sei es bei der Arbeit.
Früher hat mich das oft getriggert. Doch ich habe gelernt, dass ich Menschen inspiriere, eine bessere Version von sich selbst zu sein. Als ich mich schließlich komplett angenommen habe, störte mich das nicht mehr – insbesondere das Einzige, was ich nicht tue: solche Spiele zu spielen.
Wenn Menschen es verheimlichen und ein Spiel mit mir spielen, zeigt das nicht nur Arroganz, sondern auch übertriebene Überheblichkeit. Und genau das sagt sehr viel über eine Person aus. Mit solchen „Gegnern“ gebe ich mich nicht ab.
Aber das kam auch mit den Jahren – ich war nicht immer so selbstsicher.
Meine Selbstsicherheit entstand durch die langwierigen Erfahrungen, die ich gesammelt habe – sogar beim Fruechtepflücken.
In Australien habe ich Mandarinen, Weintrauben, Blaubeeren, Persimonen, Äpfel, Zitronen und vieles mehr gesammelt. Wir verbrachten bis zu 10–12 Stunden am Tag draußen in der Sonne. Je nach Frucht gab es unterschiedliche körperliche Herausforderungen. Bei den Zitronen zum Beispiel gab es oft starke Stacheln, und manchmal musste man auf Bäume klettern, um die Früchte zu erreichen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit einer 25 kg schweren Tasche voller Obst am Baum klettern musste, während mich die Stacheln pieksten und die Sonne brannte. Manchmal saß da eine riesige Spinne, die aussah wie eine Tarantel, und es lag an mir, ruhig zu bleiben und zu versuchen, sie vorsichtig wegzuschieben.
Ich konnte die Hitze bei der Arbeit kaum ertragen, deshalb trug ich immer nur Tanktops statt Langarmshirts – meine Arme waren komplett zerkratzt. Aber das war mir egal. Ich wusste, dass meine junge Haut das noch aushielt. Die Schmerzen waren ertragbar, und sie gaben mir sogar ein gutes Gefühl: ein Beweis dafür, dass ich es schaffen kann, egal wie hart die Arbeit ist.
An Tagen, an denen wir zwischen den Picking Seasons warten mussten, stieg ich ins Auto und fuhr in ein Nachbardorf. Die Strecken in Australien waren sehr lang – das Land ist riesig, und oft fuhr man stundenlang, ohne auf etwas zu treffen, bis wieder einmal ein Dorf kam. Ich liebte es, die Musik im Auto auf die höchste Lautstärke zu stellen und einfach geradeaus zu fahren.
Es gab kaum Ampeln auf diesen Strecken; meistens bestand die Strecke nur aus Wald oder Steppe. Man fuhr mit dem Wind, und genau so erholte ich mich von dem eintönigen Leben des Fruchtpflückers.
An einem dieser Tage, an dem ich mich zehn Stunden lang wie ein Affe zwischen den Bäumen bewegte, um Mandarinen zu sammeln, hatte ich sehr viel Zeit für meine Gedanken. Während meine Hände arbeiteten, wanderte mein Kopf. Ich stellte mir mein Leben vor, plante meine Zukunft, dachte darüber nach, was ich machen würde, wenn ich „fertig“ bin.
Diese Gedanken wurden immer wieder von einem Satz unterbrochen: Aber wenn du Familie und Kinder hast, kannst du das nicht machen. Immer wieder. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass ich mir ein anderes, freieres Leben wünschte, als das einer Mutter oder Ehefrau. Nicht, weil ich Kinder ablehne, sondern weil das klassische Familienleben mit Einschränkungen kommt, die ich nicht bereit war einzugehen.
Ich wollte ein Leben für mich. Ein Leben, in dem ich all meine verrückten Träume ausleben kann, ohne ständig verzichten zu müssen. Nicht auf Dinge zu verzichten, nur weil ein Kind mich braucht. Genau deshalb ging ich mit diesem Thema immer sehr ernst um. Ich wusste, was es mit einem Kind machen kann, wenn es von seinen Eltern nicht geliebt, nicht gesehen oder emotional vernachlässigt wird. Ich kam selbst aus so einer Familie. Ich musste mein ganzes Leben lang daran arbeiten, all die Wunden zu heilen. Ich sah, wie stark eine fehlerhafte Erziehung das Leben eines Kindes beeinträchtigen kann und welche Folgen sie mit sich bringt. Das war mir immer bewusst. Und ich wollte niemals, dass mein Kind dasselbe durchleben muss.
Genauso wenig wollte ich, dass mein Kind meine unerfüllten Träume lebt, nur weil ich sie selbst nicht verwirklicht habe. Viele Eltern verlangen von ihren Kindern genau das, was sie selbst nie erreicht haben – ohne dem Kind zu erlauben, ein eigenes Leben zu führen. Ich wusste, wie viel Verantwortung es bedeutet, ein Kind in die Welt zu bringen, und wie groß die Verantwortung ist, dieses Kind nicht zu beschädigen, nur weil man selbst mit sich nicht im Reinen ist.
Diese Verantwortung war immer präsent in meinem Leben. Und deshalb fragte ich mich oft, ob ich vielleicht unbewusst meine Partner so gewählt habe, dass Beziehungen nie wirklich vollständig wurden – damit es nie zu Kindern kommen konnte. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Mit diesem Gedanken habe ich mich nie tief genug auseinandergesetzt. Aber er hat mich oft gekreuzt. Und vielleicht werde ich es im nächsten Kapitel meines Lebens noch angehen.
An einem dieser Tage, als ich wieder einmal zwischen den Bäumen in meinem „Habitat“ unterwegs war, kam mir spontan die Idee, meine Haare ganz kurz zu schneiden – vielleicht sogar eine Glatze zu tragen. Diese verrückte Idee wurde nicht in Australien geboren; sie schlummerte tief in meinem Unterbewusstsein. Für mich bedeutete sie Freiheit, Rebellion, endlich die Last der Erwartungen loszulassen. Es war etwas, das als innerer Schrei rauskommen musste. Wahrscheinlich wollte ich es schon immer – jetzt konnte ich es endlich leben.
Also bat ich einen Freund, mir die Haare zu schneiden. Am selben Abend hatte ich keine Haare mehr. Zu dieser Zeit kämpfte eine enge Freundin von mir gegen Krebs, und sie musste ihre Haare wegen der Chemotherapie verlieren. Ich wollte sie auch dadurch unterstützen. Es war kein selbstloser Akt nur für sie – aber die Kombination aus vielen Faktoren und das Timing machten es perfekt. Ich lebte diesen Moment aus, voll und ganz…Leider reichte es nicht, um sie am Leben zu erhalten. Noch im selben Jahr verließ sie uns, und ich habe es nicht geschafft, ihr richtig Tschüss zu sagen – erst später an ihrem Grab. Diese Freundschaft hinterließ einen besonderen Eindruck in meinem Herzen, und ich werde noch darauf zurückkommen.
Die Glatze war auch ein Akt des Selbstschutzes. Ich wollte mich nur auf die Arbeit konzentrieren und keine romantischen Ablenkungen eingehen. Es ist ja wohl sicher, dass Männer Frauen mit Haaren mögen – also machte ich ein härteres Bild von mir selbst, weil ich innerlich eine tiefe Verletzung mit mir herum trug, die ich aus Vancouver mitgebracht hatte. Ich traute immer noch dem Mann hinterher, der mir meine verletzliche Welt geöffnet hatte, und konnte daher auf nichts wirklich eingehen – nicht einmal zum Spaß.
Ich nahm meine innere Entwicklung so ernst, dass ich sogar Blockaden aufbaute, um nicht abgelenkt zu werden. Witzig, oder? So viele Frauen versuchen alles, um Maennern zu gefallen. Ich tat genau das Gegenteil: Ich tat alles, um nicht aufzufallen.
Trotzdem war da mein inneres Ich präsent, und ich wurde trotzdem von Männern bemerkt. Ich erinnere mich an eine Situation: Ich erreichte am frühen Morgen eine Weintraubenplantage. Wir alle, Backpacker, standen bereit, um auf die Arbeitsanweisungen unseres Vorgesetzten zu hören. Ich kam mit meinem roten Auto an – ein kleiner Opel, gut genug, um von einer Farm zur anderen zu fahren.
Als ich ankam, schmunzelten ein paar Italiener auf Italienisch: „Oh, guck dir diese hier an, die kommt mit ihrem Ferrari und glaubt, sie kann hier arbeiten…" Sie hatten beim ersten Anblick das Gefühl, dass ich faul und oberflächlich sei, und wollten testen, ob ich überhaupt arbeiten kann. Sie unterschätzten mich, wie so viele und wie so oft. Was sie nicht wussten: Ich sprach Italienisch. Nicht perfekt, aber genug, um mich zu verständigen und die einfachen Sätze zu verstehen. Natürlich habe ich nicht alles von mir preisgegeben – manchmal muss man Menschen unterschätzen lassen. Sie würden schon sehen.
Und als sie mich dann allein bei der Arbeit sahen, wie ich die Aufgaben von zwei erledigte, hörte ich Sätze wie „Wow…Das hat sie alleine gemacht“. Ich überzeugte nicht mit Worten – ich tat es immer mit Taten.
In Australien habe ich so viele verrückte Dinge gemacht, die mir später halfen, zu verstehen, dass man Dinge tun muss, die man als Kind nie durfte. Wenn du als Kind schwimmen wolltest und es nicht durftest, weil deine Eltern dich nicht bringen konnten – tue es jetzt. Wenn du als Kind eine Puppe haben wolltest, die du nie bekommen hast – kaufe sie dir selbst. Du musst sie ja niemandem zeigen, sie ist für dich.
Wenn du deinem inneren Kind all das gibst, was es früher nicht haben konnte, heilt es. Je mehr du jetzt tust, was du schon immer als Kind tun wolltest, desto schneller heilt das verletzte innere Kind in dir. Es ist wie ein Stück verlorene Freiheit zurückgewinnen – und das fühlt sich unglaublich befreiend an.
Australien brachte nicht nur Freiheit mit sich, sondern auch etwas sehr Schweres.
An meinem Geburtstag im Jahr 2013 wurde ich benachrichtigt, dass meine Oma erneut einen Schlaganfall erlitten hatte und auf der Intensivstation lag. Das war mein „Geburtstagsgeschenk“.
Ohne lange nachzudenken, buchte ich am nächsten Tag einen Flug. Innerhalb von 26 Stunden war ich wieder in Deutschland. Als sie bei meiner Ankunft aufwachte und mich sah, brach etwas in mir. Der Anblick meiner zerbrechlichen Oma im Krankenhausbett erfüllte mich mit Sorgen und einer tiefen Angst.
Doch sie wurde stärker. Tag für Tag ging es ihr besser. Nach zwei Wochen fühlte sie sich so stabil, dass sie in ein normales Zimmer verlegt wurde. Und dann stand ich vor einer der schwersten Fragen meines Lebens: Gehe ich zurück und folge meinen Träumen – oder bleibe ich bei ihr?
Dieser innere Kampf war brutal. Ich wusste, dass ich mein Leben nicht für sie aufgeben konnte. Aber es fühlte sich grausam an, genau das nicht zu tun. Ich musste eine Entscheidung treffen..
Zu diesem Zeitpunkt war es die schwierigste Entscheidung meines Lebens – und der härteste Test meiner Selbstliebe: Gibst du deine Träume auf, um bei der Person zu bleiben, die du am meisten liebst?
Oder gehst du, um dein eigenes Leben zu leben?
Sie hatte vier Kinder. Diese Verantwortung konnte und durfte nicht allein auf mir liegen – zumindest nicht jetzt.
Der Abschied fiel mir unendlich schwer. Als ich mich von ihr verabschiedete, sah ich die Enttäuschung in ihren Augen. Sie hätte es mir nie gesagt, aber ich spürte es. Sie hätte sich gewünscht, dass ich bleibe. Und trotzdem glaube ich heute, dass meine Aufgabe erfüllt wurde. Dass meine Ankunft ihr die Kraft gegeben hat, diesen Abschnitt zu überstehen. Manchmal besteht Liebe nicht darin zu bleiben – sondern genau im richtigen Moment da zu sein.
Und diese Entscheidung habe ich nie in meinem Leben bereut. Ich wurde vom Universum getestet, und ich bestand diese Aufgabe. Mit Tränen in den Augen ging ich mit meiner Schwester im Fahrstuhl nach unten und ich flog zurück nach Australien. Mein ganzer Körper schmerzte, und doch tat ich das, was meine Seele von mir verlangte.
Diese innere Stimme habe ich immer gehört – und ihr immer vertraut. So lernte ich, mir selbst treu zu bleiben.
Nach meiner Rückkehr blieb ich noch sechs Monate in Australien. In dieser Zeit reiste ich über Bali, Indien, Singapur und Thailand. Ich hatte immer jemanden um mich herum. Diese kleine Reise war die Krönung meines Aufenthalts in Australien. Rückblickend hätte ich mir gewünscht, noch ein wenig länger zu reisen und die Zeit intensiver zu genießen. Ich wollte so schnell wie möglich nach Kanada zurück, um mein Modedesign-Studium zu beginnen, und habe deshalb meinen Aufenthalt in Australien um ein halbes Jahr verkürzt. Heute würde ich das anders machen: Ich hätte die Zeit nutzen sollen, um mehr zu reisen und die Erfahrungen dort noch bewusster zu sammeln.
Der Fehler lag darin, nicht im Moment zu leben. Ich wollte immer alles auf einmal, und deshalb konnte ich nicht entspannen. Mein ständiger Bewegungsdrang zwang mich weiterzugehen, obwohl ich noch sechs Monate hätte bleiben können.
So lernte ich eine neue Lektion: im Moment zu leben. Ich verstand, dass ich Geduld lernen musste. Geduld war eine neue Eigenschaft für mich – eine, die meine Schwäche ausglich. Meine Ungeduld hatte mir zuvor in finanziellen Situationen oft schlechte Erfahrungen beschert, weil ich alles sofort haben wollte.
Was ich aus diesen Ländern mitgenommen habe, ist die Erkenntnis, dass wir in der westlichen Welt alles haben – und doch oft nur jammern, wie schlecht alles ist. Viele Menschen dort leben in Armut, genießen aber die Natur, das Leben und die einfachen Dinge. Sie sind im Allgemeinen glücklicher und freundlicher, trotz weniger materieller Mittel.
Und das ist etwas, was ich mir als Ziel gesetzt hatte: eine Balance zwischen der materiellen und der geistigen Welt zu finden. Denn nur so kann man wirklich zufrieden und vollkommen leben.
Während meiner Zeit in Australien war eine Freundin aus Kanada bei mir. Sie war noch ziemlich jung, und wir hatten uns damals in Toronto bei einem Job in einem Golfclub kennengelernt. Als sie hörte, dass ich nach Australien reiste, wollte sie mitkommen. Ich hatte nicht lange überlegt und sie eingeladen. Rückblickend war das eine Art Probe für uns beide.
Sie war sehr rebellisch, klug, aber für das Farmleben nicht geeignet. Sie wollte nur Spaß haben und keine Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Irgendwie fühlte ich mich dafür verantwortlich, wie sie sich verhielt, nur weil sie mit mir unterwegs war. Schon damals war mir wichtig, dass meine Umgebung kein Spiegelbild von mir wurde – dass nicht alles, was andere taten, auf mich zurückfiel oder mein Leben beeinflusste.
Und trotz all dessen, was mich an ihr störte, liebte ich ihre rebellische Art. Irgendetwas daran zog mich an, vielleicht weil ich diesen Teil in mir selbst lange unterdrückt hatte oder nie ausleben durfte. An einem unserer freien Tage reisten wir spontan in eine Nachbarstadt, einfach um dort einen Tag zu verbringen – ohne Plan, ohne Ziel.
Dort trafen wir eine ebenso spontane Entscheidung: ein Nippel‑Piercing. Ich weiß bis heute nicht genau, ob es meine oder ihre Idee war. Wir liefen an einem Piercingstudio vorbei, und ich glaube, ich war es, die sagte: Lass uns reingehen. Irgendwo tief in meiner Seele wollte ich das schon immer einmal tun.
Wir entschieden uns auf der Stelle. Innerhalb von zwei Minuten hatte ich ein Nippel‑Piercing auf der linken Seite. Wozu das Ganze? Ein Akt der Freiheit. Ein Zeichen von Selbstbestimmung.
Heute weiß ich, dass ich viel zu streng erzogen wurde. Mir wurde als Kind so vieles verboten. Ich durfte nicht schwimmen gehen, weil meine Oma Angst hatte, ich könnte ertrinken. Ich durfte nicht lange draußen bleiben. Ich durfte so vieles nicht. Ich bin eine 5 – und das Schlimmste, was man uns antun kann, ist, uns zu kontrollieren oder uns die Freiheit zu nehmen. Und dieses ständige Nicht‑dürfen erzeugte eine rebellische Energie in mir. Ich konnte sie erst mit 27 wirklich rauslassen. Aber egal wann – Hauptsache, sie durfte endlich raus. Und das möchte ich dir auch mit auf den Weg geben: Unterdrücke deine eigenen Wünsche nicht. Lebe sie – selbst wenn es erst später im Leben geschieht. Es heilt.
Unsere Freundschaft löste sich schließlich auf, als sie irgendwann einen Betrug beging – ich möchte hier nicht ins Detail gehen. Aber ich erkenne heute: Ich zog manchmal Menschen an, die seelisch gut waren, aber nicht die innere Stärke hatten, sich selbst zu kontrollieren. Vielleicht war das ein Spiegel für mich – eine Lektion, nicht zu hart mit mir selbst zu sein, wenn ich an meinen eigenen Schwächen arbeitete.
Später schrieb mir ihre Mutter und bedankte sich bei mir. Sie sagte, sie habe sich sicherer gefühlt, weil ihre Tochter unter meiner Obhut war und wusste, dass ich auf sie aufpassen würde. Das berührte mich sehr – und bestätigte mir wieder, dass Verantwortung für andere auch bedeutet, sie zu stärken, ohne sich selbst zu verlieren.
Ich setzte mich damals selbst enorm unter Druck wegen der noch bestehenden Kredite in Deutschland, die ich gemeinsam mit meinem Exfreund monatlich abzahlte. Jeden Monat kamen zusätzlich hohe Zinsen für die Überweisungen aus Australien dazu. Es wurde immer teurer, und ich erzählte meiner Oma davon.
Sie schlug vor, die restliche Summe für etwa acht Monate zu übernehmen, damit alles auf einmal beglichen wäre. Ich nahm ihre Hilfe an. Ich bat sie nicht um das Geld – es war eine freiwillige Entscheidung von ihr, mich zu unterstützen.
Doch auch das wurde innerhalb der Familie bekannt. Mein Vater wirft mir bis heute vor, dass sie mich damals unterstützt hat. Und meine Cousine machte eine merkwürdige Bemerkung über das Wort „freiwillig“. Sie konnte es einfach nicht ertragen, dass die Verbindung zwischen meiner Oma und mir so stark war, dass sie mich sogar finanziell unterstützte.
Was dabei immer vergessen wurde: Sie eine Elternfigur für mich. Wirft man Eltern oder Großeltern vor, ihre Kinder zu unterstützen? Für mich ist das etwas völlig Natürliches. Mich belastet das bis heute nicht – im Gegenteil: Es zeigt mir nur, wie viel Neid, Missgunst und Bewertung innerhalb der Familie schon immer vorhanden waren, aber lange verschwiegen wurden.
Was sie nicht wussten: Ich habe das alles immer gespürt. Und Jahre später wurde es sogar ausgesprochen – all das, was ich schon so lange in mir getragen hatte.
Doch hier, in Australien, wurde noch etwas anderes geboren: ein offener und tiefer Hass gegen mich. In ihren Augen war es bereits unverschämt, dass ich es mir erlaubte, ein solches Leben zu führen. Und dann bekam ich auch noch freiwillige Unterstützung von meiner Oma. Für sie waren sie schließlich auch Enkelkinder.
Was sie dabei nie gefragt haben: Wie viel habe ich für unsere Oma getan? Wie präsent war ich wirklich in ihrem Leben?
Und genau das wurde gegen mich verwendet: „Du bist schlecht mit Geld, das ist deine Schwäche.“ Je mehr ich im Leben erreichte, desto stärker wurde dieser Bereich meines Lebens unter die Lupe genommen. Es wurde so oft angedeutet, dass ich irgendwann selbst angefangen habe, daran zu glauben.
Es war ein inneres Programm, das mir über die Ahnenlinie weitergegeben wurde – es war nicht meines, und ich musste es durchbrechen. Ich trage die Kraft meines Stammbaums in mir. Ich bin diejenige, die alte Muster erkennt und durchbricht – Prägungen, Programme und Dynamiken, die über Generationen weitergegeben wurden. Und genau das macht unbequem. Ich werde von der Familie nicht immer verstanden und manchmal sogar gehasst. Aber das zeigt nur, wie stark die Veränderungen sind, die ich bewirke.
Nicht jeder kann oder will sehen, wenn jemand den Kreislauf unterbricht. Deshalb stößt man damit oft auf Widerstand, Ablehnung oder Unverständnis innerhalb der Familie. Weil Veränderung Angst macht. Doch Angst war nie etwas, das ich besaß – zumindest nicht, wenn es um Veränderung ging
Und so lebte ich mein Leben immer weiter — ohne Angst.
Es gab unzählige Momente und Situationen, in denen es bei sehr konservativen Menschen allein durch das Zuhören meiner Geschichten die Haare zu Berge stehen ließ. Doch für mich fühlte sich all das nie besonders riskant an, nie extrem, sondern vielmehr wie ein natürlicher Ausdruck meines Weges.
Auf meinem Weg begegnete ich vielen interessanten Menschen — Menschen, die das Leben noch intensiver, noch radikaler lebten und die die 13. Energie in vollen Zügen genossen. Ich hingegen ging meinen eigenen Rhythmus. Vorsichtig, manchmal unüberlegt, manchmal viel zu lange überlegend — und doch immer bereit, irgendwann zu riskieren.
Denn Risiko war für mich nie bloßer Leichtsinn. Risiko war Adrenalin.
Risiko bedeutete Wachstum.
Was kannst du vom Leben erwarten, wenn du es nach den ganz normalen Mustern anderer Menschen lebst — nach jenen Mustern, die sie selbst als vernünftig erklärt haben? Doch was ist überhaupt vernünftig? Akzeptiert zu werden? Geliebt zu werden?
Nicht aus der Reihe zu tanzen — und wofür eigentlich?
Damit irgendwann irgendeine Karen, die ihr Leben lang nichts gewagt hat, eine Bewertung über dein Leben abgeben kann?
Ist es das wirklich wert, dafür dein eigenes Leben klein zu halten?
Ich habe sehr früh verstanden, dass mein einziges Vorbild immer ich selbst sein sollte.
Jeden Tag ein kleines Stück besser als am Tag zuvor.
Ja, ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht — weil ich nicht in den besten Verhältnissen aufgewachsen bin, weil es keine Person gab, die mich jemals zu hundert Prozent verstehen konnte, und weil ich auf irgendeine Art und Weise immer wieder Abwertung erlebte.
Ich habe viele Jahre meines Lebens verschenkt.
So viel Zeit an Menschen, die sich von meinem Potenzial nährten — während sie mich gleichzeitig immer weiter nach unten zogen.
Besonders deutlich zeigte sich das in engen Freundschaften. Nie ganz offen. Nie eindeutig sichtbar. Immer lag eine Schicht darüber — eine feine Tarnung, die alles verdeckte, weil man mich ja im Leben behalten wollte. Nicht aus Liebe. Sondern aus Bedürftigkeit.
Erst als ich begann, wirklich an mir selbst zu arbeiten, veränderte sich etwas. Nicht von einem Tag auf den anderen. Nicht plötzlich. Nicht laut.
Es war ein jahrelanger Prozess — ein leiser Weg, der mich Schritt für Schritt stärkte, mich selbstbewusster machte und mir schließlich die wahren Gesichter meiner Umgebung zeigte.
Nicht, um mich zu verletzen. Sondern, um mich endlich zu mir selbst zurückzuführen.
so führten mich meine Wege auch immer wieder in gefährliche Situationen — Momente, in denen mein Mut und meine Geduld auf eine stille, aber eindringliche Weise geprüft wurden.
Noch immer in Australien machte ich mich eines Tages gemeinsam mit einer Freundin aus Taiwan auf den Weg nach Brisbane. Wir wollten shoppen gehen, weil ich mir einen Koffer für meine bevorstehende Reise zurück nach Kanada kaufen musste. Die Fahrt dauerte etwa drei Stunden, und eigentlich hätten wir problemlos in der Stadt übernachten können. Es war bekannt — beinahe eine unausgesprochene Regel — dass man in Australien nachts nicht fährt, wegen des wilden Nachtlebens der Tiere, das die Straßen in der Dunkelheit
unberechenbar macht.
Doch ich fühlte mich nach Hause gezogen.
Ich wollte unbedingt in meinem eigenen Bett schlafen. Ich wollte nicht noch eine weitere Nacht unterwegs verbringen, nicht noch einmal fremde Wände um mich haben. Also machten wir uns auf den Weg zurück — obwohl ich wusste, dass man nachts in Australien
nicht fährt.
Dass die Strecke von Brisbane durch dunkle, endlose Wälder führt, in denen es keinen Handyempfang gibt.
Dass Kängurus, Wombats und Emus unvermittelt auf die Straße springen können — schwer, massiv, unberechenbar — und ein Zusammenstoß nicht nur ein Auto zerstören, sondern auch das eigene Leben gefährden kann.
Ich wusste, dass riesige Trucks diese Straßen nutzen, dass es Geschichten über verschwundene Backpacker gibt, Geschichten, die man sich abends am Feuer erzählt und am nächsten Morgen wieder verdrängt. Und ich wusste auch, dass selbst in den scheinbar warmen Sommermonaten — die in Australien eigentlich als Wintermonate angesehen werden — die Nächte so kalt werden, dass der Körper ohne Jacke zu zittern beginnt, still wird, langsamer wird.
Und doch fuhr ich los. Getragen von einer inneren Ruhe, die stärker war als jede Vernunft.Nicht aus Leichtsinn. Nicht aus Trotz.
Sondern aus einem tiefen, unerklärlichen Drängen heraus — als würde etwas in mir flüstern, dass dieser Weg gegangen werden musste, auch wenn er sich im Dunkeln verlor.
Und so wurde es auch bestätigt.
Es war stockdunkel. Wir fuhren durch den Wald — ohne Empfang, ohne Licht, ohne jede Orientierung außer der schmalen Straße vor uns. Ich fuhr schneller, als es vielleicht empfohlen wird, wenn man nachts durch australische Wälder fährt, aber nicht so schnell, dass es sich für mich wie ein echtes Risiko anfühlte. Es war dieses Zwischenmaß — jenes
Tempo, bei dem man glaubt, noch alles unter Kontrolle zu haben.
Bis es passierte…
Etwas sprang von links direkt auf das Auto zu.Es war ein harter, dumpfer Aufprall — ein brutales Bum-Geräusch, das durch den ganzen Wagen ging. Das Auto stoppte abrupt, und wir hielten in Angst und völliger Überraschung an.
Ich hatte es für einen Sekundenbruchteil gesehen — diese Bewegung aus dem Dunkel — doch ich war nicht schnell genug gewesen, um rechtzeitig zu bremsen.
Ein paar Sekunden vergingen, bis wir beide überhaupt verstanden, was geschehen war. Die Stille danach war fast noch beängstigender als der Aufprall selbst.
Ich stieg aus, um herauszufinden, was es gewesen war. Hatte ich Angst, dass etwas mich anspringen könnte? Ja — vielleicht ein wenig. Aber nicht wirklich. Meine größere Sorge war eine andere: dass dieses Wesen tot sein könnte.Und genau so war es.
Es war ein Wallaby - ein Tier, das einem Känguru ähnelt, nur kleiner, kompakter. Ein Känguru hätte mein Auto bei dieser Geschwindigkeit vermutlich vollständig zerstört.
Schließlich war es nur ein kleiner Opel.
Doch etwas anderes fiel mir sofort auf. Wasser begann aus dem Kondensator zu laufen.
Wahrscheinlich war der Aufprall nicht nur durch das Tier selbst entstanden, sondern auch durch einen Stein am Boden, auf den das Auto beim Zusammenstoß geschlagen war.
Wir stiegen sofort wieder ein. Ein wenig traurig wegen des Tieres — und doch mit dem klaren Ziel, weiterzufahren.
Aber etwas stimmte nicht.
Das Auto ruckelte. Es sprang nicht mehr richtig an. Der Motor reagierte nicht. Und plötzlich saßen wir da.
Ohne Jacken.
Es war 21:00 Uhr.
Mitten im Nirgendwo.
Ein Auto, das nicht ansprang. Keine Wärme. Kein Handyempfang. Keine Lichter.
Nur Dunkelheit, Wald — und diese wachsende Stille, die sich langsam um uns legte…Vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, dass es in den Sommermonaten — so wie in den Winterzeiten der westlichen Länder — in Australien sehr früh dunkel wird. Doch diese Dunkelheit ist mit nichts zu vergleichen, was man aus Europa kennt. Sie ist nicht einfach nur Nacht. In Australien ist Dunkelheit vollständig.Man sieht nichts. Nicht einmal einen Schatten. Kein Umriss, keine Bewegung, keinen Übergang zwischen Licht und Finsternis.
Die Welt scheint zu verschwinden.
In solchen Momenten beginnen tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf zu strömen — Szenarien, Ängste, Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Und doch geschah etwas Eigenartiges.
Während das Außen vollkommen unsicher wurde, wurde es in mir ruhig.
Ich wusste, dass jetzt keine Panik helfen würde.Dass Angst nichts verändern konnte.
Dass es keinen Grund gab, verrückt zu werden.
Ich wusste — auf eine Weise, die nicht erklärbar ist — dass alles gut sein würde.
Diese Ruhe war nicht neu. Sie hatte mich mein ganzes Leben begleitet. Und vielleicht in dieser Nacht im Wald verstand ich zum ersten Mal wirklich, woher sie kam.
Als ich vier Jahre alt war, veränderte sich meine Welt. In diesem Alter versteht ein Kind keine Gründe, keine Entscheidungen, keine Erklärungen.
Es spürt nur, dass sich etwas grundlegend verschiebt — dass die Welt, wie sie einmal war, nicht mehr dieselbe ist.
Von diesem Moment an lebte ich zwischen zwei Welten.
Nicht mehr ganz dort, wo ich herkam.
Noch nicht wirklich dort, wo ich nun war.
In diesem Dazwischen begann meine innere Welt zu entstehen.
Ein stiller Raum, den ich mir schuf, lange bevor ich Worte dafür hatte. Ein Ort, an dem ich Ordnung fand, während das Außen wechselte. Ein Ort, an dem ich bleiben durfte, wenn nichts sicher schien.
Dort lernte ich früh etwas Entscheidendes: ruhig zu werden, um zu überleben.
Nicht aus Kälte. Nicht aus Abwesenheit von Gefühl. Sondern aus Schutz.
Während andere Kinder Halt im Außen fanden, musste ich ihn in mir selbst erschaffen.
Und genau diese frühe innere Ordnung wurde später zu meiner Stärke.
In schwierigen Situationen übernimmt sie bis heute die Führung.
Wenn Unsicherheit entsteht, wenn Gefahr spürbar wird, wenn alles schwankt, wird es in mir still — nicht leer, sondern klar.
Diese Kontrolle ist kein bewusster Akt. Sie ist Erinnerung.
Die Erinnerung eines vierjährigen Kindes, das zwischen zwei Welten lebte und dort lernte, sich selbst zu halten.
In jener Nacht im australischen Wald war ich wieder dort — nicht als Kind, sondern als erwachsene Frau. Und doch war es dieselbe innere Stimme, dieselbe Ruhe, derselbe Raum, der mich trug.
Nicht, weil nichts hätte passieren können.
Sondern weil ich gelernt hatte, ruhig zu bleiben, wenn das Leben unsicher wird.
Und vielleicht war genau das der Moment, in dem sich der Kreis schloss — zwischen damals und jetzt, zwischen Kindheit und Gegenwart, zwischen Angst und Vertrauen.
Ich vertraute darauf, dass alles gut ausgehen würde. Und genau so war es.
Nach etwa einer Stunde — vielleicht auch etwas länger — sprang der Motor plötzlich wieder an. Nicht, weil ich wusste, wie man ihn repariert, sondern weil ich immer wieder versucht hatte, ohne Hast, ohne Druck, getragen von dem Gefühl, dass Aufgeben jetzt keine Option war.
Wir konnten weiterfahren.
Vor uns lagen noch etwa zweieinhalb Stunden Fahrt. Doch ich wusste: Wenn wir es nur aus diesem dunklen Wald hinaus schaffen würden, wäre es bereits gut genug. Dann gäbe es zumindest eine Straße, vielleicht ein Licht, vielleicht irgendein Ort, an dem Hilfe möglich wäre.
Und tatsächlich — irgendwann erreichten wir eine Landstraße.
Am Rand stand ein einziges Haus.
Licht brannte darin. Wir hielten kurz an, sahen einander an und überlegten, ob wir dort anhalten oder einfach weiterfahren sollten. Es waren schließlich nur noch etwa anderthalb Stunden bis nach Hause.
Also fuhren wir weiter. Das Wasser lief die ganze Zeit weiter aus dem Wagen, und niemand wusste, was sich währenddessen im Inneren des Autos abspielte — welche Schäden entstanden waren, welche Teile bereits nachgegeben hatten und ob wir überhaupt noch sicher weiterfahren konnten.
Doch kaum waren wir ein paar Meter entfernt, meldete sich meine innere Stimme — leise, aber klar.
Geh zurück. Frag dort nach Hilfe.
Diese Stimme begleitet mich mein ganzes Leben lang. Diese Stimme ist mein Schutz.
Und ich lernte sehr früh, auf sie zu hören.
Ohne lange Diskussion drehten wir um und hielten an dem Haus an der Kreuzung.
Die Menschen hatten unser Auto bereits gehört. Noch bevor wir richtig ausgestiegen waren, kamen mehrere Personen nach draußen. Es war eine Familie — Mutter, Vater, zwei Töchter und der Freund einer der Töchter.
Und dieser Freund war zufällig Kfz-Mechaniker.
Sie nahmen uns warm auf, als würden sie uns kennen. Sie boten uns Essen an, eine warme Dusche, ein Bett für die Nacht. Während wir endlich wieder Wärme spürten, stellte der Freund das Auto in die Garage und begann zu schauen, was passiert war.
Am frühen Morgen hatte er das Loch provisorisch geklebt. Es sollte ausreichen, um sicher nach Hause zu kommen, damit ich das Auto später in eine Werkstatt bringen konnte.
Alles geschah so selbstverständlich. So menschlich. So still. Wir waren Fremde. In einem fremden Land. Mitten in der Nacht.
Und doch öffneten diese Menschen ihre Tür, ihre Garage, ihr Zuhause — ohne Zögern, ohne Angst, ohne Misstrauen.
Am späten Nachmittag, nachdem der Kleber etwa acht Stunden getrocknet war, verabschiedeten wir uns. Wir fuhren langsam los, dankbar, berührt, beinahe sprachlos — und kamen heil nach Hause.
Das war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens.
Ein Segen. Ein schicksalhafter Moment. Ein stiller Beweis dafür, dass es noch immer sehr viele gute Menschen gibt — Menschen, die ihre eigene Angst zur Seite stellen, um zu helfen.
In diesem Moment fragte ich mich, ob jemand in Europa wohl dasselbe getan hätte. Und leider formte sich in mir sofort eine leise, traurige Antwort — weil dort oft zuerst über Gefahr gesprochen wird, bevor man dem Herzen zuhört. Diese Menschen aber handelten aus dem Augenblick heraus. Aus einer inneren Klarheit.
Aus Menschlichkeit.
Für mich war es ein Zeichen — vielleicht sogar ein Gruß unserer Engel.
Ich wusste, diese Nacht sollte mir etwas zeigen.
Einen Beweis dafür liefern, was innere Ruhe bewirken kann — und was geschieht, wenn man der Angst nicht erlaubt, die eigenen Gedanken zu kontrollieren.
Denn dort, wo Vertrauen bleibt, findet das Leben immer einen Weg.
Einige Wochen nach diesem Ereignis — nachdem das Auto repariert worden war — fuhr ich noch einmal zurück. Dieses Mal nicht aus Not, nicht aus Angst, sondern mit einer Kiste voller Bier und Süßigkeiten im Kofferraum.
Ich wollte mich bedanken.
Nicht nur für die Hilfe in jener Nacht, sondern für die Menschlichkeit, die sie uns geschenkt hatten. Für die Wärme, die sie uns gaben, als wir fremd waren. Für das Vertrauen, das sie uns entgegenbrachten, ohne Fragen zu stellen.
Ich wollte diese Herzlichkeit weitergeben.
Ich wollte, dass sie sehen, dass ihr Handeln etwas bewirkt hatte — dass es nicht selbstverständlich war, nicht übersehen, nicht vergessen.
Dass solche Gesten Spuren hinterlassen.
Denn genau das wollte ich ihnen zeigen: dass ihre Offenheit und Unterstützung gesehen und geschätzt wurden.
Und gleichzeitig spürte ich etwas Tieferes in mir.
Wie viel schöner diese Welt wäre, wenn solche Momente nicht als Ausnahme empfunden würden — sondern als etwas
Selbstverständliches.
Wenn Hilfe nicht zuerst durch Angst gefiltert würde. Wenn Menschlichkeit nicht erklärt, sondern gelebt würde.
Vielleicht war auch das ein Teil der Botschaft dieser Nacht: dass Güte sich vervielfacht, wenn man sie weiterträgt.
Und dass jede kleine Handlung — so unscheinbar sie wirken mag — die Welt ein wenig heller machen kann.
Australien hinterließ einen besonderen Wert in mir. Dort erlaubte ich meinem inneren Ich,
endlich hervorzutreten — so frei, so ungezähmt und so lebendig zu sein, wie es sich meine
Seele immer gewünscht hatte.
In Australien ging ich keine romantischen Beziehungen ein. Diese Zeit war nicht dafür gedacht. Ich las sehr viel, verbesserte dadurch meine Englischkenntnisse, verbrachte unzählige Stunden mit mir selbst und begann, mich auf eine tiefere Weise kennenzulernen — jenseits von Ablenkung, jenseits von äußeren Rollen.
An einem dieser Tage, während wir auf die nächste Picking Season warteten, saßen meine Freundin und ich auf der Farm. Wir lebten in einer einfachen Donga, container-artiges Wohnmodul, und an diesem Nachmittag lagen wir draußen auf der Wiese — auf einer Decke. Ich las, sie spielte auf ihrem Handy. Alles war still, weit, fast zeitlos.
Bis ich plötzlich ihre Stimme hörte.
Ganz ruhig sagte sie mir, ich solle mich nicht umdrehen.
Und wie es der menschliche Reflex in solchen Momenten ist, drehte ich mich dennoch um.
Etwa einen Meter von unserer Decke entfernt bewegte sich — fast traumartig — eine braune Schlange. Sie glitt langsam über die Wiese, direkt aus Richtung des Feldes. Für einen Moment wirkte alles unwirklich: die Sonne blendete, das Gras war intensiv grün, und mitten darin bewegte sich eines der gefährlichsten Tiere der Welt. Es war eine Eastern Brown Snake — eines der giftigsten Lebewesen dieses Kontinents. Ihr Gift wirkt schnell, lautlos und gnadenlos. Ein einziger Biss kann innerhalb kurzer Zeit das Nervensystem lähmen, die Blutgerinnung zerstören und selbst gesunde Erwachsene in Lebensgefahr bringen, wenn nicht sofort medizinische Hilfe erfolgt.
Doch ihre Gefährlichkeit liegt nicht nur in ihrem Gift, sondern in ihrer Unberechenbarkeit. Sie greift nicht aus Jagd an, sondern aus Verteidigung — oft schneller, als das menschliche Auge reagieren kann. Ein einziger falscher Schritt, eine unbedachte Bewegung, ein Moment der Panik hätte ausgereicht.
Ihr Körper war schlank, muskulös, perfekt angepasst an Geschwindigkeit. Jede Bewegung wirkte kontrolliert, fast lautlos, als würde sie mit dem Boden verschmelzen. Sie brauchte keine Drohgebärde, kein Zischen — ihre bloße Anwesenheit war Warnung genug.
In dieser Sekunde wurde mir bewusst, wie dünn die Grenze zwischen Leben und Gefahr manchmal ist. Wie still sie sein kann. Und wie wenig es braucht, damit sich alles verändert.
Aber sie schien uns vollkommen ignoriert zu haben — als wären wir gar nicht da.
Wir hielten inne. Völlig still. Wie eingefroren.
Niemand wusste, was zu tun war.
Als sich die Schlange langsam ein Stück von uns entfernte, begann meine Freundin nach dem ehemaligen Mitarbeiter der Farm zu rufen — einem Mann, der bereits im Ruhestand war und noch auf dem Gelände lebte.
Die Schlange kroch unter einen Holzstapel und verschwand dort.
Es war Winter in Australien — vermutlich ein Julitag. Eigentlich hätte sie zu dieser Zeit gar nicht draußen sein sollen. Vielleicht war sie deshalb so träge, so langsam.
Der Mann hieß Mof.
Er kam heraus, sichtbar verwundert darüber, dass wir ihn aus seinem Mittagsschlaf geweckt hatten. Mit einem fragenden Blick wollte er wissen, was los sei. Wir erklärten ihm die Situation. Ohne große Worte ging er in seinen Trailer, holte einen Besen und begann damit, kräftig auf den Holzstapel zu schlagen, um die Schlange herauszutreiben.
Und dann war sie wieder da. Sie kroch hervor — nicht aggressiv, nicht angreifend, eher verwirrt.
Mof schlug mehrmals auf die Wirbelsäule der Schlange, bis er überzeugt war, dass sie tot sei. Wir konnten kaum glauben, was wir sahen — denn ihr Körper bewegte sich weiterhin. Er erklärte uns ruhig, dass sich der Körper einer Schlange noch bis zu einer Stunde nach dem Tod bewegen könne.
Schließlich hob er sie mit dem Besen auf und legte sie in eine große Schüssel.
Er sagte, man müsse einer Schlange immer das Rückgrat brechen — so tötet man sie… Ein Tierschutzmitglied würde sich über diese Situation vermutlich aufregen. Ja — ich fand es traurig, dass die Schlange sterben musste. Und gleichzeitig war mir bewusst, dass es auch einer von uns hätte sein können, wenn sie nicht vom Gelände vertrieben worden wäre… Und wieder wurden wir von einem Schutzengel bewahrt.
Ja — wir hatten richtig gehandelt. Wir waren stehen geblieben, hatten innegehalten, hatten nichts überstürzt. Diese innere Ruhe hatte es möglich gemacht, dass die Schlange uns nicht als Gefahr wahrnahm — und wir nicht angegriffen wurden.
Hätten wir aus Angst reagiert, wäre vielleicht alles anders gekommen. Vielleicht würde ich heute dieses Buch nicht schreiben können. Denn Angst macht laut, unkontrolliert, sichtbar.
Sie sendet Unruhe aus — und Unruhe wird in der Natur als Bedrohung erkannt.
So aber blieb alles still. Und wieder zeigte sich, dass innere Ruhe nicht Schwäche ist, sondern ein tiefer Schutzinstinkt. Eine Kraft, die den Menschen selbst aus den gefährlichsten Situationen führen kann — wenn er ihr vertraut.
Das Universum hat uns ein Schutzengel geschickt.
Diesmal in der Gestalt von Mof.
Nicht spektakulär. Nicht überirdisch.
Ein alter Mann mit einem Besen in der Hand — und doch genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Vielleicht sind Schutzengel manchmal genau das: Menschen, die ohne Zögern handeln, wenn andere noch überlegen.
Und vielleicht erinnert uns das Leben genau dadurch daran, dass wir niemals wirklich allein sind — solange wir bereit sind, zu vertrauen.
Mof war fünfundsiebzig Jahre alt. Ein Australier alter Schule.
Ein Mann, der sein ganzes Leben mit solchen Tieren gelebt hatte — mit Respekt, aber ohne Angst.
Nach der Arbeit fuhr er jeden Abend mit den anderen Farmarbeitern in eine kleine lokale Bar. Dort traf sich das ganze Dorf. Man trank ein paar Bier, tauschte sich aus, kannte einander.
Mundubbera war eine kleine ländliche Gemeinde, etwa 400 Kilometer nordwestlich von Brisbane, gelegen am Burnett River. Es lebten dort nur etwas über tausend Menschen — und genau deshalb kannte jeder jeden. Das Leben war überschaubar, ruhig, beinahe zeitlos.
Und genau das war das soziale Gefüge dieses Ortes: Gemeinschaft, Nähe und einfache Gespräche nach einem langen Tag — nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Diese Szene blieb tief in mir. Nicht wegen der Schlange — sondern wegen der Selbstverständlichkeit, mit der das Leben dort genommen wurde.
Roh. Echt. Und vollkommen präsent.
Im September 2014 war für mich die Zeit gekommen, nach Hause zu gehen. Ich verließ Australien mit tiefer Dankbarkeit für all die Erfahrungen und das innere Wachstum, das diese Zeit in mir hinterlassen hatte, und hielt für eine Woche in Deutschland an, bevor es weiternach Kanada gehen sollte — dorthin, wo mein Studium beginnen würde.
Ich besuchte meine Oma und meine Familie und spürte, dass ich bereit war, ein neues Leben anzufangen. Ein Leben in der westlichen Zivilisation. Es bedeutete für mich, die materielle Welt wieder in mein Leben einzuladen — bewusst, achtsam und mit dem Wissen, dass sie nicht mehr mein Maßstab sein durfte, sondern nur ein Teil meines Weges.
Diese Woche in Deutschland fühlte sich wie ein stiller Übergang an — ein bewusstes Innehalten zwischen zwei Kapiteln meines Lebens.
In dieser Zeit heiratete auch eine Cousine von mir. Zu dieser Hochzeit wurde auch mein Exfreund eingeladen.
Er kam bei meiner Schwester an, und wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns nach der Trennung in einem geschützten Rahmen zu sehen. Es war das erste Mal, dass wir uns seit unserem Abschied wieder begegnen würden. Schließlich gab es noch einige Möbelstücke, die wir damals bei seinem Onkel untergestellt hatten und die nun abgeholt werden mussten.
Wir regelten alles ruhig und respektvoll, teilten die Dinge auf — einiges ging zu meinen Eltern, anderes verkaufte ich.
Doch bei diesem Treffen ging es nicht um Gegenstände. Es ging um das emotionale Loslassen.
Ich wollte nicht, dass unsere Familie unser Wiedersehen während der Hochzeit beobachtet.
Ich erlaubte mir nicht, dass etwas so Persönliches zur Schau gestellt wurde…
Als er bei meiner Schwester ankam, öffnete ich die Tür — und fiel in seine Arme. Es war ein gesundes Gefühl. Das Wiedersehen mit einem Menschen, der lange Zeit sehr wichtig für mich gewesen war.
Wir waren im Guten auseinandergegangen. Und in dieser Umarmung zeigte sich all das, was noch da war: Wertschätzung, Dankbarkeit und Respekt für das, was wir miteinander erlebt hatten — und gleichzeitig die klare Gewissheit, dass ich emotional bereits einen ganz anderen Weg ging.Ich war ihm dankbar für unsere gemeinsame Zeit. Doch mein Leben hat sich längst weiter bewegt.
Kurz nach der Hochzeit meiner Cousine verließ ich Deutschland erneut — diesmal mit einem klaren Plan im Herzen: Kanada. Ein neuer Abschnitt wartete bereits auf mich